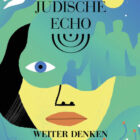Zunbada wulubu tumba ba-umf von Erhard Stackl
Dada: die erste Weltsprache der Avantgardekunst, ihre Vorbilder im rumänischen Schtetl und die Geschichte einer Vertreibung
Dada-Dada, Dada-Dada, Dada-Dada! Dada-Dada, Dada-Dada, Dada-Dada!
Dada-Dada, Dada-Dada, Dada-Dada! Dada-Da- da, Dada-Dada …
Rhythmisch abgehackt wie die Salven eines Maschinengewehrs zerrissen die Stimmen grotesk maskierter Männer im Februar 1916 die Luft in einem kleinen Veranstaltungslokal in Zürich. Tristan Tzara, ein eleganter junger Mann mit Monokel, fingerte auf der Bühne aus den Taschen seines Anzugs einige Papierfetzen, von denen er rätselhafte Gedichte ablas. Nur die Wörter „ma mère“, „mon père“ und „merde“ waren zu verstehen. Dann traten vier schwarz gekleidete Männer auf Stelzen mit „Simultangedichten“ gegeneinander an, zischten, jaulten und ratterten, bis das Publikum vor Empörung tobte. Schließlich erschien Hugo Ball auf der Bühne, der früher in München mit Frank Wedekind Theater gemacht hatte und mit der Kabarettsängerin Emmy Hennings nach Zürich gekommen war. Nun trug er, vom Künstler Marcel Janco mit einem Kostüm aus Karton als kubistischer „Dada-Bischof“ ausstaffiert, ein Lautgedicht vor: „Zunbada wulubu ssubudu uluw ssubudu tumba ba-umf.“
Mitten im Ersten Weltkrieg brach im Cabaret Voltaire eine internationale Künstlergruppe im Schweizer Exil wie ein Gewitter über die Kunstwelt herein. Ihre Provokationen richteten sich gegen die Absurdität der Kunst und auch des Lebens in Zeiten von Megazerstörung und massenhaftem Tod. In Zürich hatten damals Intellektuelle aus vielen Ländern, darunter auch James Joyce und Franz Werfel, Zuflucht gefunden. Lenin wohnte ganz in der Nähe der „Meierei“, in der die Dadaisten allabendlich wüteten.
Hier sei „die erste Weltsprache der Avantgarde“ entstanden, konstatierten Kunsthistoriker später1.
Über den Surrealismus und alle nachfolgenden Schattierungen der Gegen- und Antikunst bis zur Performance wirkt die dadaistische Revolution bis in die Gegenwart nach. Doch was heute gern als der künstlerische Urknall von 1916 beschrieben wird, als Neustart ohne Vorbilder, dürfte eine ausführliche Vorgeschichte haben. Sie führt ins Osteuropa des 18. und des 19. Jahrhunderts, genauer: in einige entlegene, von frommem Judentum geprägte Städte in Rumänien.
Diese Entdeckung machte der schwedische Kunsthistoriker Tom Sandqvist, der über „Dada East“ für die renommierte US-Universität MIT (Massachusettes Institute of Technology) eine ausführliche Studie schrieb2, die 2010 erstmals auch auf Rumänisch publiziert wurde. Mehr als die Hälfte der Ur-Dadaisten von Zürich waren jüdische Exil-Rumänen, stellte Sandqvist fest: Tristan Tzara (*1896), Marcel Janco (*1895) und seine jüngeren Brüder Jules und Georges sowie der Maler Arthur Segal. Sie stammten aus wohlhabenden, an der französischen und deutschen Kultur orientierten Familien; in Zürich inskribierten sie Philosophie an der Universität oder, wie Marcel Janco, Architektur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH).
In Rumänien seien Artefakte zur Vorgeschichte der Avantgardekunst um die vorige Jahrhundertwende während der kommunistischen Diktatur in den tiefsten Archivkellern verschwunden, schreibt Sandqvist. Erst etliche Jahre nach dem blutigen Umbruch von 1989 erhielt er als erster Forscher Zugang zu den Dokumenten, die von Rumäniens künstlerischer Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg übriggeblieben sind.
Ein großer Teil dieser Künstler gehörte der 300.000 Menschen umfassenden jüdischen Minderheit unter den sechs Millionen Bewohnern des Königreiches Rumänien an. In Städten wie Iaşi oder Moineşti, wo Tzara als Samuel Rosenstock geboren wurde, machten Jiddisch sprechende Chassiden die Mehrheit aus. An den jüdischen Festtagen versuchten sie, allen irdischen Schwierigkeiten zum Trotz, in Gebeten, Liedern und Tänzen, auch mit religiöser Ekstase, dem Schöpfer näherzukommen.
Dabei waren die Schwierigkeiten kaum zu ertragen. Der rumänische Staat gewährte nur einem Bruchteil der jüdischen Bevölkerung die vollen Bürgerrechte, mehrheitlich blieben sie „Fremde“. Der antisemitische Druck und das materielle Elend wurden so groß, dass zwischen 1900 und 1914 an die 100.000 Juden aus Rumänien auswanderten. Da sich Österreich-Ungarn gegen die Aufnahme mittelloser Emigranten sperrte, wurden ihnen Pässe nur für Reiseziele in Übersee (USA, Kanada, Argentinien) ausgestellt.
Trotz dieser erdrückenden Lage hielten die jüdischen Gemeinden am Brauch fest, zu Purim den weltlichen und selbst den religiösen Autoritäten ins Gesicht zu lachen. Gefeiert wird am 14. Tag des Monats Adar (Februar/März), wie erinnerlich, die Rettung der Juden durch Esther, die Frau des persischen Königs Achaschwerosch (Xerxes I.). Dessen Minister Haman plante, so die Geschichte, die Ermordung aller Juden im Perserreich an einem einzigen Tag; durch das Los (hebräisch „Pur“) wurde dafür der 13. Adar bestimmt. Haman begründete den angedrohten Massenmord damit, dass sich der fromme Jude Mordechai geweigert habe, vor ihm niederzuknien. Auf Vermittlung von Königin Esther, die Mordechais Adoptivtochter war, wurde Haman auf Speisen und Wein zu König Achaschwerosch eingeladen, der ihn dann aber festnehmen und hinrichten ließ. Die Juden erhielten durch Esthers Fürsprache das Recht, sich gegen die von Haman ausgesandten Angreifer zu verteidigen und setzten sich gegen diese am nächsten Tag durch.
Er ist seither ein Freudentag, der mit Essen und Wein gefeiert wird. Nicht nur Kinder verkleiden sich, ähnlich wie die Christen beim Karneval, vertreiben Haman mit hölzernen Ratschen und lassen sich die süßen Teigtaschen schmecken.
In der durch den ungewohnt reichlich fließenden Alkohol gelockerten Feieratmosphäre sei es in den Jiddisch sprechenden Gemeinden Osteuropas dann ähnlich turbulent zugegangen wie später im Züricher Cabaret Voltaire, schreibt der Kunsthistoriker Sandqvist. Zu rhythmischem Klatschen wurden Lieder immer wieder gesungen, bis die Worte in eine unverständliche Lautmalerei übergingen. Seit dem 17. Jahrhundert war es an diesem Feiertag zudem erlaubt, das Buch Esther und andere biblische Geschichten in „Purimspielen“ mit Laienschauspielern und oft auch als Parodien in Szene zu setzen.
David Maayan, ein in Israel geborener Theatermacher, der seit einigen Jahren in Österreich lebt, hat dem Autor dieser Zeilen heuer bestätigt, dass es vom Purimspiel zu modernen Theaterformen Verbindungslinien gibt. Zu Purim konnte man seinem Ärger Luft machen und den Mächtigen zurückreden, meint Maayan. Das Tragen von Masken machte es möglich, dabei sehr weit zu gehen. Es sei ziemlich anarchisch zugegangen, weil manche getrunken hätten, bis sie Mordechai und Haman nicht mehr auseinanderhalten konnten. Künstlerisch betrachtet gehe es dabei um größtmögliche kreative Freiheit.
Anlässlich des Kulturfestivals Linz 2009 inszenierte David Maayan in dem Stollensystem, das während des Zweiten Weltkriegs von Zwangsarbeitern aus Mauthausen in der oberösterreichischen Hauptstadt gegraben worden war, eine grell-bunte, schockierende Version des Purimspiels. Der Bühnenautor Joshua Sobol („Ghetto“, „Alma“) hatte ihm dafür den Text in einer künstlichen Sprache geschrieben, die er als „eingedeutschtes Jiddisch“ bezeichnete. Die Schauspieler, von denen manche Schweinemasken trugen, stellten singend und polternd Esthers Geschichte dar. Gegen Schluss wird Haman gehenkt, doch nachher verschwinden die übrigen Akteure in dieser radikal zeitgenössischen Version des Purimspiels in einem großen Kasten, der die Shoah symbolisiert.
Ende des 19. Jahrhunderts war das rumänische Iaşi ein Zentrum des damals modernen jiddischen Theaters, dessen Begründer der aus der Ukraine stammende Abraham Goldfaden war. In seinem bekanntesten Drama, „Bar Kochba“, geht es um den letzten jüdischen Aufstand gegen die Römer, doch viele seiner aus dem Purimspiel hervorgegangenen Stücke hatten satirische Züge. Der österreichische Schriftsteller Joseph Roth wunderte sich nach dem Besuch einer jiddischen Theatervorstellung über die Lautstärke und das ekstatische Chaos der Darbietung. (In späteren Jahren zeigte auch Franz Kafka großes Interesse für das jiddische Theater.)
Der schwedische Kunsthistoriker Tom Sandqvist, der in Rumänien das Umfeld der späteren Dadaisten erkundete, ist sich sicher, dass hier ihre Vorbilder waren. Tzara, Segal & Co blieben freilich nicht in den Provinzstädten, sondern zogen nach Bukarest, wo es auch die Familie Jancos zu etwas gebracht hatte. Bei aller Starrheit und Intoleranz bot die rumänische Gesellschaft, die überwiegend aus Bauern bestand, gebildeten und flexiblen Menschen auch große Chancen. Junge Juden, die sich von frühester Kindheit an in Bücher vertieft und Wissen absorbiert hatten, stürzten sich in die freien Berufe, in den Journalismus und die Kunst.
Bereits als 17-Jähriger veröffentliche Tristan Tzara (zunächst unter dem Namen S. Samyro) experimentelle Gedichte in Literaturzeitschriften, für die auch Marcel Janco arbeitete. Ihre Begeisterung galt den italienischen Futuristen, die in Manifesten das neue Zeitalter der Flugmaschinen und der Geschwindigkeit feierten.
Ein künstlerisches Porträt von Lajos Tihanyi (1885–1938): So sah er Tristan Tzara (1896–1963) im Jahre 1927.
(Foto: wikipedia/Lajos Tihanyi)
Später, in Zürich, wandte sich Tzara vom Futurismus ab, weil dieser zum kriegstreiberischen Wegbereiter des Faschismus geworden war. Als Dadas größter Propagandist trat Tzara nun selbst mit künstlerischen Proklamationen3 auf. Im Dada-Manifest von 1918 (an dem der aus Wien kommende Walter Serner mitgeschrieben hatte) heißt es: „Im Prinzip bin ich gegen Manifeste, wie ich auch gegen Prinzipien bin.“ Und: „Ich bin gegen die Aktion; und was den ständigen Widerspruch und auch die Zustimmung betrifft, so bin ich weder für noch gegen sie. Ich will das nicht näher erklären, denn ich hasse den gesunden Menschenverstand.“
Vom Schtetl in die große Welt
1919 kamen in Zürich bis zu 1500 Zuschauer zu den in einen größeren Saal umgezogenen Dadaisten, die noch immer für Skandale sorgten. Daneben gaben sie eine Zeitschrift heraus und stellten in einer Galerie Werke eigener Künstler, aber auch von Picasso aus. Tzara korrespondierte mit aller Welt, in die sich die Dadaisten nach Kriegsende bald zerstreuten.
In Deutschland zog Dada zahlreiche weitere Künstler in seinen Bann, darunter Otto Dix, George Grosz, John Heartfield, Max Ernst, Kurt Schwitters und den in Wien geborenen Raoul Hausmann. Dezidiert politisch traten sie mit entlarvend karikierender Kunst gegen den aufkommenden Nationalsozialismus an. (Nach dessen Machtübernahme als „entartete Künstler“ verfemt, wurden sie, wie „Dada-Max“ Ernst, ins US-Exil vertrieben oder, wie Walter Serner, im KZ ermordet.)
In den USA war, zeitgleich mit Dada, um Marcel Duchamp und Man Ray eine ähnliche Kunstrichtung entstanden, die sich, wie dann auch der Surrealismus, gegen alle Traditionen wandte. Tristan Tzara selbst ging nach Paris und machte, nach anfänglichem Zögern, bei André Bretons Surrealisten mit. Er heiratete die wohlhabende Schwedin Greta Knutson und konnte es sich leisten, mit der Planung seines Hauses in Paris einen international bekannten Architekten zu beauftragen: den Wiener Adolf Loos.
Politisch wandte sich Tzara, vom Aufstieg Hitlers alarmiert, den französischen Kommunisten zu. Im Spanischen Bürgerkrieg war er Propagandist für die republikanische Sache. Während des Zweiten Weltkriegs gestaltete er von Südfrankreich aus Kulturprogramme für einen Radiosender der Résistance. 1956 reiste Tzara nach Budapest, wo er sich mit den oppositionellen Intellektuellen solidarisierte. Als die Sowjets den ungarischen Aufstand niederwalzten, trat er aus der KP aus. Künstlerisch konnte er seine frühen Erfolge nicht wiederholen. Vor seinem Tod 1963 trat er aber noch als scharfer Kritiker des Algerienkriegs der Franzosen in Erscheinung. Rumänien, wo seine Werke lang verboten waren, hatte er zuletzt 1947 besucht.
Marcel Janco kehrte bereits 1922 nach Bukarest zurück. Als Architekt plante er dort etliche Villen im kühlen konstruktivistischen Stil. Gleichzeitig stellte er seine Gemälde aus und lud zu den Ausstellungen Da-da-Kollegen wie Hans Arp (der schon in Zürich dabei gewesen war) und Kurt Schwitters ein.
Marcel Janco 1954 im Künstlerdorf von Ein Hod in Israel.
(Foto: Government Press Office/National Photo Archive)
In der rumänischen Gesellschaft wurde die Feindseligkeit gegenüber Juden immer stärker. Künstler wie Janco wurden als „Zerstörer“ der bodenständigen Kultur diffamiert. Obwohl sie schon länger wieder ans Weggehen gedacht hatten, machten die Jancos erst im Jänner 1941, nach blutigen Pogromen der Eisernen Garde, damit Ernst.
Über Istanbul fuhren die Jancos per Schiff nach Palästina; im Februar 1941 trafen sie in Tel Aviv ein. Nach der Gründung des Staates Israel initiierte Janco die Künstlergruppe Neue Horizonte, die dort die abstrakte Malerei durchsetzte. 1953 begründete er in den Ruinen des Dorfes Ein Hod, südöstlich von Haifa, eine inzwischen weltbekannte Künstlersiedlung. Auch der Wiener Maler Arik Brauer hat für sich dort ein Haus ausgebaut. 1983, ein Jahr vor Marcel Jancos Tod, wurde in Ein Hod, wo es sogar ein Café Voltaire gibt, das Janco Dada Museum mit seinen Bildern und Masken eröffnet.
In seiner Anfangszeit war Ein Hod übrigens, wie eine Chronistin des Künstlerdorfs berichtet4, in ganz Israel für seine alljährlichen „wilden Purim-Bälle bekannt“, bei denen Marcel Janco selbst als Perser verkleidet auftrat.
1 Karin Thomas: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. DuMont-Verlag, Köln 1998.
2 Tom Sandqvist: Dada East. The Romanians of Cabaret Voltaire. MIT Press, Cambridge MA 2006.
3 Tristan Tzara: Sieben Dada Manifeste. Edition Nautilus, Hamburg 1978.
4 Susan Slyomovics: The Object of Memory. University