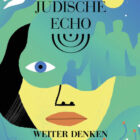The Sound of Österreich von
 Als junge österreichische Jüdin in New York, wo das Österreichbild vieler Menschen zwischen Hüttengaudi und Mauthausen angesiedelt ist.
Als junge österreichische Jüdin in New York, wo das Österreichbild vieler Menschen zwischen Hüttengaudi und Mauthausen angesiedelt ist.
Ich war nie besonders gerne Österreicherin. Zunächst lag es an der Sprache. Englisch lernen stellte sich nämlich als mühsam heraus. Obwohl ich schon im Kindergartenalter Unterricht bekam, tat ich mir lange schwer, die englischsprachigen Verwandten zu verstehen oder ihnen zu sagen, was ich dachte. Wäre ich doch nur Amerikanerin oder Engländerin, dachte ich oft, dann könnte ich akzentfrei Englisch sprechen.
Dazu kam, dass man sich für Österreich außerhalb von Österreich kaum interessierte. Ich träumte davon, einmal so richtig weltberühmt zu werden, und mir fehlten richtig weltberühmte österreichische Menschen als Vorbilder. Arnold Schwarzenegger? Turnen war nicht meine Stärke. Falco? Singen leider auch nicht. Mozart? Meine Blockflötenkompositionen klangen mehr nach sterbendem Vogel als nach Konzerthaus.
Julie Andrews in „Sound of Music“: Ewiges Österreich-Klischee.
(Foto: 20th Century Fox Home Entertainment)
Und dann war da meine Familie. Die war nämlich anders als die Familien vieler meiner österreichischen Schulfreundinnen. Während die in den Ferien auf den Bauernhof der Großeltern in die Steiermark oder auf das Familienanwesen ins Waldviertel fuhren, besuchten uns die Verwandten aus London und New York und Israel. Die brachten oft tolle Geschenke, sänk ju wäri matsch. Bisweilen wäre ich aber lieber im Dirndl mit den Dorfkindern am Kirtag herumgehüpft. Oder hätte eine Erstkommunion gehabt, im weißen Kleid. Schön wäre auch ehrlicher Enthusiasmus vonseiten meiner Eltern gewesen, wenn ich selbstgebastelte Osterhasen, Miniaturkrippen und Heiligenbilder nach Hause brachte.
Ich wusste, dass das mit meinen Großeltern zu tun hatte. Nach dem Krieg waren sie irgendwie in Wien gelandet. Der eine Großvater kam aus einer Wohnung im siebten Bezirk, in dem ihn ein befreundeter Arzt zweieinhalb Jahre versteckt hatte. Der andere Großvater kehrte aus einem Internierungslager in der Schweiz zurück in seine Heimatstadt, gemeinsam mit seiner Frau, die er dort kennengelernt hatte und die aus Berlin stammte. Und die andere Großmutter wusste nach der Befreiung aus Theresienstadt auch keine andere Destination als ihren Geburtsort.
Ich hatte also von früh an ein vages Verständnis davon, dass Menschen, die in diesem Land lebten und leben, meinen Vorfahren großes Leid zugefügt hatten, weil meine Familie jüdisch ist. Mir ging es allerdings ausgezeichnet, weshalb ich mit dem Unrechtsgefühl wenig anfangen konnte. Keine Weihnachten zu feiern und dennoch von den Schulfreundinnen beschenkt zu werden oder im Krippenspiel als stolzer Engel aufzutreten, dank meiner Körpergröße noch dazu meist in der vordersten Reihe, machte mich nicht zu einem Opfer von Diskriminierung. Das Unwohlsein mit meiner österreichischen Identität war dennoch präsent und wuchs, je mehr ich die Geschichte meines Heimatlandes verstand. Ich versuchte dieses Gefühl zu artikulieren und trug als Teenager T-Shirts mit rotem Stern und Anarchie-Zeichen und sprach mit naivem Zynismus über Politik.
Jüdisches New York: Spezialitäten aus einem der bekannten „Delis“, etwa Bagels mit Räucherlachs.
(Foto: DW Labs Incorporated/shutterstock.com)
Dann ging ich mit Anfang zwanzig nach Amerika. Nach New York, um genau zu sein, und man hört oft, New York sei ja nicht das „richtige“ Amerika. Das mag in vielen Aspekten stimmen, denn die Stadt hat mehr Bioläden und weniger Waffen als andere Teile des Landes. Doch wenn man das jüdische Amerika kennenlernen will, ist New York authentisch. Zehn Prozent der Bevölkerung, oder rund 800.000 Menschen, sind Juden. Zu Jom Kippur schließen die öffentlichen Schulen. Ich lernte schnell, dezent angebrachte Mesusot an Geschäftseingängen zu erkennen.
Ich stürzte mich ins jüdische Leben. Hier gab es schließlich alles, auch für ungläubige Seelen wie die meine. Ich arbeitete bei einer jüdischen Zeitung, ging zu Schabbatessen, aß Bagels mit Räucherlachs, unterhielt mich mit Männern, die mir nicht die Hand gaben, und las Bücher über rasant wachsende chassidische Sekten. Die Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft faszinierte mich. Es gab aufregend viele Dinge, über die man sich streiten konnte: Zahlt der Staat für die Jeschiwa? Dürfen Frauen Tefillin anlegen? Wie intensiv waren Juden am Sklavenhandel beteiligt?
Ich wollte dazugehören und an meine Identität als Österreicherin eigentlich nicht erinnert werden. Wenn jemand meinen Akzent nicht zuordnen konnte, bedankte ich mich für das Kompliment. Endlich, jubilierte ich, konnte ich mich im „Schmelztiegel Amerika“ ein wenig neu erfinden, als selbstbewusste Jüdin und entspannte Kosmopolitin.
Das Glück währte jedoch meist nur kurz. Schließlich wollte man wissen, wo mein mysteriöser Akzent herkam. „I’m from Austria“, antwortete ich wahrheitsgetreu. Oft folgte darauf ein kurzes Schweigen. „Australia?“, hörte ich gelegentlich. „Vienna is supposed to be beautiful“, kam bisweilen. Oder: „‚The Sound of Music‘ is my favorite movie.“
„Wenn man das jüdische Amerika kennenlernen will, ist New York authentisch. Zehn Prozent der Bevölkerung, oder rund 800.000 Menschen, sind Juden. Zu Jom Kippur schließen die Schulen.“
Aber noch viel häufiger stieß ich auf Argwohn. Vor allem die jüdischen Amerikaner mochten Österreich nämlich noch weniger als ich. Die Vergangenheit war zu präsent. „Meine Großmutter ist von dort. 1938 entkam sie auf einem Kindertransport“, hörte ich oft. Oder: „Mein Großvater lebte im zweiten Bezirk, bis 1938.“ Als Jüdin aus Österreich wurde ich als Kuriosität betrachtet und stieß auf Mitleid und Unverständnis. „Wie jetzt, und deine Großeltern sind dortgeblieben?“ – „Fühlt ihr euch denn sicher?“ – „Freud war auch Jude aus Wien!“
Diese Fragen und Bemerkungen, fand ich, dienten eindeutig dazu, mir vor Augen zu führen, dass ich in Österreich nichts zu suchen hatte. Für mich schwang ein Vorwurf mit: Wie konnte ich als Jüdin in einem Land mit solch einer Vergangenheit – und Gegenwart – eine zufriedene Jugend verbracht haben? Juden seien immer Außenseiter, und deshalb würde ich in Österreich nie dazugehören.
„Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, was mit mir geschah. Viele Menschen, mit denen ich verkehrte, kannten Österreich nur aus Geschichten ihrer Großeltern und aus Holocaust-Filmen.“
Ich fühlte mich angegriffen. Auf einmal war es mir wichtig, dass man Österreich verstand und nicht verurteilte. Ich bemühte mich, ausgewogene Antworten zu geben. Nein, ich hatte keinen Antisemitismus selbst erlebt. Ja, mit der Restitution hatte man sich Zeit gelassen, österreichische Gemütlichkeit eben. Ja, in Wien leben noch Juden, und zwar gar nicht so wenige. Natürlich, ich vermisse meine Familie und Freunde. Kornspitz mit Liptauer fehlt mir auch, und Wiener Kaffeehäuser. Oh ja, meine Urgroßeltern wären auch gerne hergekommen, aber es gab eine Einwanderungsquote in den Vereinigten Staaten. Ich weiß, unsere stimmenstarke rechtspopulistische Partei beunruhigt mich, aber zu sagen, dass fast ein Drittel der Bevölkerung Nazis sind, stimmt auch nicht.
Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, was da mit mir geschah, wieso ich das Land, aus dem ich nicht gerne war, verteidigte. Viele Menschen, mit denen ich verkehrte und die diese Fragen stellten, kannten Österreich nur aus den Geschichten ihrer Großeltern und aus Holocaust-Filmen. Gelegentlich hatten sie Eindrücke vom Skiurlaub („I love apple strudel“) und wenig ruhmvollen Ereignissen der österreichischen Politik („I remember Waldheim!“).
Deshalb hatte ich die Fragen und Kommentare missverstanden. Sie zweifelten nicht an meiner österreichischen Identität. Sie stellten nicht infrage, ob ich in dieses Land hineinpasste. Ganz im Gegenteil. Für sie war ich Österreicherin, was ich nicht sein wollte, und sie wollten verstehen, wie ich hineinpasste, in ihr Österreichbild, zwischen Hüttengaudi und Mauthausen. Und das musste ich mir nun überlegen. In die Verteidigungsstellung gedrängt, war ich gezwungen, mit Klischees aufzuräumen, den amerikanischen ebenso wie meinen eigenen. Und zu erkennen: Ich war zwar nie besonders gerne Österreicherin. Ob ich es will oder nicht, bin ich aber österreichischer als die Besetzung von „Sound of Music“. Sogar der Akzent stimmt.
- Anna Goldenberg (Foto: privat)