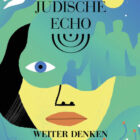„Sie hatten eine gemeinsame Mission“ von Stefanie Oswalt

Stefanie Oswalt – Foto: Privat
Teddy Kollek und Ari Rath gelten als die „zwei Löwen aus Wien“ in Jerusalem. Der „Porzellangassenbub“ Rath und der in einem 130 Kilometer von Budapest entfernten Dorf geborene, aber in Wien aufgewachsene Kollek haben durch ihr Wirken in wichtigen Entwicklungsphasen Israels unauslöschliche Spuren hinterlassen.
Sie sind zwei große Söhne der Stadt Wien – spät geliebt, doch dafür umso leidenschaftlicher: Teddy Kollek und Ari Rath sind zu Ikonen geworden, die in Wien, Österreich, aber auch in Deutschland noch zu ihren Lebzeiten von Politikern, Kulturschaffenden, Intellektuellen besungen wurden – als Exponenten von Frieden und Versöhnung, als Brückenbauer, nicht nur hinsichtlich der Spannungslinien einer divergierenden israelischen Gesellschaft oder des ungelösten israelisch-palästinensischen Konflikts. Sondern natürlich und ganz besonders auch als Protagonisten eines Dialogs mit den Nachgeborenen der nationalsozialistischen Barbarei im jungen Staat Israel. Protagonisten, die freilich durchaus zur Vorsicht mahnten, die Kontinuitäten rechten Denkens hierzulande kritisierten und vor wiedererstarkendem Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Xenophobie warnten, die grundsätzlich aber bereit waren, ein „anderes, ein neues Deutschland“ anzuerkennen. Und auch ein „anderes Österreich“ – auch wenn dies deutlich länger dauerte – bis zur eindringlichen Rede von Bundeskanzler Franz Vranitzky vor dem Nationalrat am 8. Juli 1991, in der dieser sich zur Mitschuld Österreichs am Nationalsozialismus bekannte.
Teddy Kollek und Ari Rath waren sich durch Herkunft, Überzeugungen, persönlichen Neigungen in vielem so nahe und ähnlich, dass ich bei der Recherche häufig ins Schmunzeln geriet: etwa wenn es über Teddy Kollek heißt, er sei ein leidenschaftlicher Sammler von Büchern und Kunstgegenständen gewesen, sein Haus übervoll davon – und ich mich dann an Ari Raths enge, mit aktuellen zeitgeschichtlichen Büchern, Schriften, Papieren, Fotos und Bildern vollgestopfte Wohnung in Motza oder der Jerusalemer Keren-Kayemet-Straße erinnerte. Wenn ich über Teddy Kolleks Leidenschaft für seine Arbeit las, ein Mann, der nie rastete, der unentwegt arbeitete, nachts und zum Verdruss religiöser Juden auch am Schabbat, und der beim Antritt zu seinem Bürgermeisteramt im Jahr 1965 als Erstes die Devise ausgab, keine Lunch-Besprechungen oder gar Dinner-Partys in seinen Terminplan aufzunehmen, weil dafür schlicht keine Zeit sei.
Auch Ari Rath saß bis zuletzt jeden Augenblick an seinem Computer, aufmerksam, neugierig, in Kontakt mit seinen vielen Kollegen, Freunden, Kulturschaffenden, Familie in aller Welt, immer die journalistischen Antennen ausgefahren, auf der Suche nach dem neuesten Scoop – und um noch die geringsten optimistisch klingenden Nachrichten aus dem Nahen Osten aufzusaugen, zu kommunizieren und zu kommentieren – wobei man allerdings sagen muss: Eine Verabredung zum Essen oder eine Dinner-Einladung hätte Ari Rath sicher nie ausgeschlagen, weder zu seinen aktivsten Zeiten bei der „Jerusalem Post“ noch später.

Kollek-Tochter Osnat mit einem von ihr gemalten Porträt ihres Vaters: Sein wichtigstes Lebensziel war das Vertrauen Ben-Gurions
Foto: Emil Salman
Da ist schließlich die formidable Begabung der beiden, mit Menschen sofort eine persönliche Beziehung herzustellen, egal, aus welchem Milieu sie kamen oder welche Bildung sie genossen hatten, ob sie in Ost- oder Westjerusalem lebten, egal ob israelischer oder palästinensischer Herkunft, Deutsche oder Österreicher oder welcher Nationalität auch immer, egal welcher Religion, ob jung oder alt, arm oder reich. Dazu gehört sogar der Umgang mit dem eigenen Namen. Theodor Kollek, genannt „Teddy“ – ein verniedlichender Kosename. Ein Mann, der sich Teddy nennen lässt, und das nicht nur innerhalb des Familien- und Freundeskreises, signalisiert, dass er ansprechbar ist, dass er sich vor Nähe nicht fürchtet.
Ari Rath hatte in Österreich als Arnold Rath das Licht der Welt erblickt. Nach seiner Flucht vor den Nazis und der Ankunft in Palästina im November 1938 wollte er diesen germanisch klingenden Namen allerdings nicht mehr tragen und entschied sich für den seines Großvaters mütterlicherseits: Aron Leib: „Leib ist der jiddische Name für Löwe, auf Hebräisch heißt Löwe Arjeh. Der gemeinsame Nenner dieser drei Vornamen Arnold, Aron, Arjeh war dann Ari … Es war eine gute Entscheidung: Das kurze Ari hat Barrieren zu fremden Menschen oft schnell beseitigt und mir zudem den Umgang mit hohen Politikern erheblich erleichtert.“1
Ich habe Ari Rath 1993 bei einer Journalistenreise nach Israel kennengelernt und später mit ihm seine Memoiren geschrieben. Jahrelang habe ich ihn interviewt, egal wo wir uns trafen. Leider, so sehe ich bei der Durchsicht der alten Notizen und Transkripte, sprach Ari Rath nur beiläufig über Teddy Kollek, den er fraglos als einen der großen israelischen Entscheider seiner Zeit darstellt. Ihn habe mit Teddy Kollek eine „lebenslange Freundschaft“ verbunden, heißt es in Ari Raths Memoiren.2 Dass dies keine Übertreibung ist, belegen Zeitzeugen aus dem persönlichen Umfeld der beiden, etwa Teddy Kolleks Tochter Osnat, die sich erinnert, dass Ari Rath häufig bei ihren Eltern zu Gast war – Gelegenheiten, bei denen intensiv und in vertrauensvoller Atmosphäre debattiert und diskutiert wurde. Oder Ari Raths langjährige Lebenspartnerin Anneli Halonen, eine finnische Diplomatin, die sich an häufige Besuche bei den Kolleks erinnert. Dann habe man über die neuesten Errungenschaften für Jerusalem, die Situation im Land und die Weltpolitik diskutiert: „Teddy und Ari hatten die Nähe der früheren ‚Wiener Buben‘ miteinander“, erinnert sie sich, und: „Kissinger gehörte sofort dazu, wenn er in Israel zu Besuch war.“3
Bezeichnenderweise erwähnt Teddy Kollek Ari Rath in seinen beiden autobiografischen Büchern4 nicht. Das ist aus seiner Perspektive wenig verwunderlich. Teddy Kollek hatte schon als junger Mann viel Aufregendes im Dienste seiner zionistischen Mission erlebt, hatte schon jung das Vertrauen des späteren Staatsgründers David Ben Gurion erworben, war vertraut mit allen, die später für das politische Schicksal Israels wichtig werden würden, hatte bald eine eigene Familie mit zwei Kindern und verkehrte als Bürgermeister Jerusalems nicht nur mit den Schwergewichten aus der politischen Welt, sondern auch aus den Bereichen der Wissenschaft und Kunst: Albert Einstein und Arthur Rubinstein, Isaac Stern, Marc Chagall. In Kolleks kleiner Jerusalemer Wohnung (dritter Stock, kein Aufzug!!) war die niederländische Königin zu Gast, und legendär ist das Bild, das Teddy Kollek in seiner eigenen Wohnung zu Füßen von Marlene Dietrich zeigt.
Teddy Kollek ist außerhalb von Wien heute mit Sicherheit die ungleich bekanntere und zeitgeschichtlich vielleicht wichtigere Figur, und das liegt nicht nur an seinem Altersvorsprung von 14 Jahren. Es lohnt sich aber, dem Gedanken nachzugehen, dass sein Schaffen für Jerusalem auch deshalb so erfolgreich war und er auch deshalb international so bekannt wurde, weil er in seinem Kreis mit Menschen wie Ari Rath zusammenarbeitete und weil beide aus Wien eine Prägung mitbrachten, die für den Aufbau des neuen Staates Israel und der Entwicklung einer zeitgemäßen Marke „Jerusalem“ eine wichtige Voraussetzung darstellte.
Man wird mit Sicherheit sagen können, dass Teddy Kollek für Ari Rath eine wichtige Orientierungsfigur darstellte. Vor allem in seinen jungen Jahren. Ari Rath kam allein ins Land – ein 13-jähriger Jugendlicher –, das Cover seiner Autobiografie zeigt seine tiefe Verstörung und Verzweiflung. Ari Raths Leben hatte mit dem „Anschluss“ im März 1938 eine dramatische Wendung erfahren – nach dem frühen Tod seiner Mutter, die sich das Leben genommen hatte, als er vier Jahre alt war, schon die zweite. Teddy Kollek hatte die Entscheidung für Palästina ganz bewusst getroffen und war gemeinsam mit seiner Frau Tamar 1935 ausgewandert. Schon im Elternhaus wurde er mit den zionistischen Visionen seines Namensgebers Theodor Herzl vertraut gemacht, die Zeit in der zionistischen Jugendbewegung Blau-Weiß hatte ihn tief geprägt und bereits als junger Mann fand er seine Lebenspartnerin Tamar. Sie teilte seine Visionen und war bereit, die Bequemlichkeit einer Jugend in Wien aufzugeben, um die eigenen sozialistischen Ideale zu verwirklichen: auf der Ostseite des Sees Genezareth im Kibbuz Ein Gev.
Ari Rath kam aus deutlich anderen Wiener Verhältnissen – als Sohn eines Papiergroßhändlers, der die bescheidenen Verhältnisse in Galizien hinter sich gelassen und sich im Wien der Zwischenkriegszeit emporgearbeitet hatte: Geräumige Wohnverhältnisse, Kindermädchen und Köchinnen, ein Chauffeur, der den Vater zur Arbeit brachte, die Sommerfrische am Semmering, der Bechsteinflügel – all dies prägte die Jugend von Ari Rath. Er wuchs nicht mit zionistischen Idealen auf – obwohl sein Vater, wie er sich erinnert, gelegentlich für zionistische Zwecke spendete und er Palästina 1936 sogar besucht hatte.
Doch in der Familie Rath war jeder Gedanke an eine Alija nach Palästina verpönt. Obwohl die antisemitische Stimmung in Wien zunahm: „Überhaupt stand ich dem Zionismus noch sehr fern. Zwar erhielten wir zu Hause neben dem Klavierunterricht auch Hebräischstunden, doch war das hauptsächlich als Vorbereitung für meine Bar Mitzwa. An Auswanderung dachte in unserer Familie damals niemand. Trotz aller besorgniserregenden Ereignisse richteten sich unsere Zukunftsgedanken und Pläne weiterhin auf Wien. Wir fühlten uns als gebürtige Wiener, auch wenn wir ab und zu von länger Ansässigen und eher assimilierten Wiener Juden abfällig als ‚polnische Juden‘ verspottet wurden.“5
Erst der „Anschluss“, die Enteignung des Vaters und seine Inhaftierung in Buchenwald und Dachau lösten bei Ari und seinem drei Jahre älteren Bruder Meshulam (damals noch Maxi) den Wunsch aus, nach Palästina auszuwandern, in ein Land, schreibt Ari Rath, „von wo wir nie wieder vertrieben werden würden“.6 Menschen, die die zionistischen Ideale früher als er selbst entdeckt hatten, begegnete Ari Rath mit großer Verehrung, das gilt für seine Madrichim in der Wiener Jugendbewegung Gordoniah – Sinai Ucko und Aaron Menczer –, es galt aber in besonderem Maße für politische Führungsgestalten wie David Ben Gurion – oder eben auch Teddy Kollek.

Ari Rath spricht bei einem Empfang der „Jerusalem Post“ im King David Hotel von Jerusalem zu israelischen Spitzenpolitikern: Auf Teddy Kolleks Spuren
Foto: Saar Yaacov/Israel Government Press Office
Mit der Flucht aus Wien hatte auch Ari Rath seine Mission gefunden – das Fundament, das eine lebenslange Beziehung zu Teddy Kollek ermöglichte: den Aufbau des jüdischen Staates und später bald eben auch: die Schaffung einer weltoffenen Stadt Jerusalem, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion miteinander in Frieden leben konnten. Ich sage „Mission“ und beziehe mich dabei auf eine Formulierung von Osnat Kollek, die mir in einem ausführlichen Interview über die Beziehung der beiden im Januar dieses Jahrs sagte: „They were friends not because of their personality. But for their mission.“ Diese Mission muss sie schon sehr bald zusammengeführt haben – Ari schreibt, er habe Teddy Kollek schon sehr früh in der zionistischen Jugendbewegung in Palästina kennengelernt. Gut denkbar, denn als Delegierter des Kibbuz Chamadiya, den er 1945 mit Chawerim aus seiner Schulzeit in der Ahava von Haifa im Jordantal gründete, nahm er an vielen Treffen der Kibbuzbewegung teil.
Ari Rath benennt das Jahr 1947 als das Jahr, in dem beide erstmalig miteinander zusammenarbeiteten. Rath war damals von der zionistischen Jugendbewegung in die USA entsandt worden, um junge amerikanische Juden für ein Leben in Palästina zu werben. Teddy Kollek, damals Leiter der politischen Abteilung der Jewish Agency, war von Ben-Gurion nach New York entsandt worden. Ben-Gurion hatte keine Illusionen darüber, dass die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina zu blutigen Auseinandersetzungen mit den arabischen Nachbarn führen würde, und wollte daher Vorkehrungen treffen, um dort illegal Waffen zu beschaffen und sie nach Palästina zu bringen. „Viele enge Mitarbeiter um David Ben-Gurion stammten aus Wien, was ich mir damit erkläre, dass sie eleganter und geschmeidiger auftraten als die häufig sehr starrköpfigen deutschen Jeckes. Teddy Kollek nahm dabei eine herausragende Rolle ein“7 , überlegt Ari Rath in seiner Biografie.
Schon bald nach seiner Ankunft in New York habe Kollek ihn zur Mitarbeit aufgefordert.8 Teddy Kollek hat in seinen Memoiren ausführlich über diese abenteuerliche Tätigkeit geschrieben, die er aus einer Suite im New Yorker Hotel Fourteen heraus organisierte – ganze Flugzeuge kaufte er zur illegalen Verschiffung nach Palästina, aber vor allem Waffen, Granaten, Munition. Für eine solche Geheimagententätigkeit brauchte es Menschen, auf die man sich hundertprozentig verlassen konnte, die sich hundertprozentig loyal verhielten. Ari Rath: „Jeder, der mit Teddy Kollek einmal zusammengearbeitet hat, weiß, was es bedeutete, von ihm einen Auftrag zu erhalten: Man übernahm die Verantwortung von Anfang bis zum Schluss, inklusive aller Unwägbarkeiten … Noch heute pocht mir das Herz bei dem Gedanken, mit welcher Chuzpe ich damals täglich mehrmals in einem geliehenen Lieferwagen durch New York kutschierte“9 – mit als Konservendosen getarnten Granatenlieferungen, die er aus einem alten Lagerhaus in Brooklyn zur Verladung in den Hafen expedieren musste.

Ari Rath und Teddy Kollek: Lebenslange Freunde aus dem Umfeld Ben-Gurions, die sich in ihren Autobiografien kaum übereinander äußerten
Foto: Archiv Carmel Zamir
Es war nicht nur die hundertprozentige Loyalität zu Teddy Kollek, die Ari Rath leitete, sondern auch die absolute Devotion, die er für David Ben-Gurion empfand. Auch dies hat die beiden miteinander verbunden: ihre Bewunderung, die Bereitschaft, all ihr Tun und Trachten in den Dienst Ben-Gurions zu stellen, dem charismatischen Gründervater, dessen politischen Weitblick und dessen Entschlossenheit beide zutiefst bewunderten. Auf ihre Frage, was für ihn das wichtigste erreichte Ziel im Leben gewesen sei, habe ihr Vater gesagt: „Dass Ben Gurion mir vertraut hat“, erinnert sich Osnat Kollek. Auch in Aris Erinnerungen ist spürbar, wie sehr ihn die Begegnung mit Ben-Gurion beeindruckt und geprägt hat. Die große Faszination für Ben-Gurion mag verwundern angesichts seiner kürzlich erschienenen, von Tom Segev verfassten Biografie. Er zeichnet Teddy Kolleks und Ari Raths Idol als anmaßenden Egozentriker mit einer Neigung, Menschen vor den Kopf zu stoßen, humorlos, rücksichtslos, manchmal boshaft und kleinlich. Ben-Gurion, so zitiert Segev einen Bekannten, habe sich nicht wirklich für Menschen interessiert, sondern nur dafür, wie sie einsetzbar waren.10 Für Teddy Kollek, wie für Ari Rath, hatte Ben-Gurion die perfekten Einsatzfelder gefunden: 1952–1965 arbeitete Kollek als eine Art Kabinettschef für Ben-Gurion, und bei der Wahl 1965, als Teddy Kollek für das Amt des Bürgermeisters kandidierte, übernahm Ari Rath bei Ben-Gurion das Amt des persönlichen Sekretärs.
Nachdem Ben-Gurion die Wahlen von 1965 verloren hatte, kehrte Ari Rath zur „Jerusalem Post“ zurück. Es würde sich lohnen, das Wirken der „Jerusalem Post“ für die weltweite Rezeption Jerusalems (und Israels) einmal detailliert aufzuarbeiten. Ari Rath hat darüber in einer „Wiener Vorlesung“ über Teddy Kollek aus Anlass seines hundertsten Geburtstags 2011 knapp formuliert: „Teddy Kollek hatte immer eine offene Tür bei uns in der ‚Jerusalem Post‘. Und ich hatte immer eine offene Tür bei ihm im Rathaus von Jerusalem. Wir hatten meistens freundliche Beziehungen sowohl mit gegenseitiger Kritik als auch mit gegenseitiger Schätzung. Als Bürgermeister von Jerusalem versuchte Teddy Kollek in der schicksalsvollen Zeit im Juni 1967 die israelischen und palästinensischen Bürger der Stadt in Harmonie und mit Toleranz zu regieren. Wir in der ‚Jerusalem Post‘ versuchten eine Brücke der gegenseitigen Verständigung zu bilden.“11
Ich möchte dem zwei, drei Überlegungen hinzufügen: Da wirkten nun zwei Wiener an entscheidenden Stellen: beide aufgewachsen mit den Annehmlichkeiten einer fortschrittlichen, entwickelten Metropole in Mitteleuropa – mit einer funktionierenden Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Theatern, Museen, Konzerthäusern, einer qualitativ hochwertigen Presse im Wien der Zwischenkriegszeit, beide Lokalpatrioten für die Stadt Jerusalem und gleichzeitig „Männer von Welt“: Teddy Kollek im Rathaus mit dem Willen, die noch in vielem rückständige Stadt Jerusalem für alle Bewohner lebenswerter zu machen und sie auf ein internationales Niveau anzuheben: durch die Verbesserung der Infrastruktur und vor allem durch Ankurbelung des Tourismus.12
Ari Rath bei der „Jerusalem Post“, bei der er 1958 angeheuert hatte und deren Chefredakteur und Herausgeber er von 1975 bis 1989 war. Die „Jerusalem Post“ – solches ist im digitalen Zeitalter schlicht gar nicht mehr vorstellbar – stellte damals das mit Abstand wichtigste Informationsorgan in nicht-hebräischer Sprache dar: ein Medium, das, weil englischsprachig, weltweit rezipiert wurde, zugleich aber eine israelische Perspektive einnahm. Ari Rath hat sich immer gerühmt, aus diesem ursprünglich ziemlich regierungstreuen Provinzblatt über die Jahre eine seriöse, unabhängige und liberale Zeitung geformt zu haben. Und wer durch Ausgaben von 1958 und jenen von 1989 blättert, sieht den Wandel: Da gibt es internationale und lokale Berichterstattung auf höchstem Niveau, da gibt es Gastkommentare und es gibt zum Schabbat wöchentlich eine mindestens 16-seitige Beilage namens „In Jerusalem“ mit detaillierten Veranstaltungshinweisen, Konzerttipps, Ausstellungs-, Theater- und Buchkritiken: ein Blatt, das Einheimische und Touristen gleichermaßen informiert und so auf publizistische Weise zur Offenheit und Attraktivität der Stadt erheblich beiträgt.
Teddy Kollek, schreibt der israelische Journalist Amos Elon, sei als Bürgermeister nicht mehr ein Kandidat der Arbeitspartei gewesen, sondern einfach ein glaubwürdiger Anwalt der Interessen der Jerusalemer Bürger. Kollek habe sich nie an die Bürger angebiedert, habe Probleme nie verschwiegen, sondern nachvollziehbar um Kompromisse und einen Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichsten Bürgern der Stadt gerungen. Um eine ähnliche Unabhängigkeit bemühte sich Ari Rath auch als Chefredakteur seiner Zeitung, wobei sein Herz politisch links schlug und er auf einen Frieden mit den arabischen Nachbarn hoffte. Als sich im November 1977 der ägyptische Präsident Anwar el-Sadat ziemlich überraschend zu Friedensgesprächen bereit zeigte und nach Jerusalem reiste, führte ihn Teddy Kollek durch die Heilige Stadt bis zum Tempelberg, wo Sadat betete – und Ari Rath begleitete das Event mit einer Sonderausgabe der „Jerusalem Post“. Wenig später erschien im Verlag der Zeitung sogar ein Sonderalbum, „Sadat in Jerusalem“.13
Dass das Ende ihrer öffentlichen Aufgaben für beide Löwen mit Bitterkeit verbunden war, ist bekannt, weist aber wiederum Parallelen auf. Etwas vereinfacht lässt sich wohl auch sagen, dass der Rechtsruck der israelischen Gesellschaft, die zunehmende Einflussnahme religiöser und ultraorthodoxer Kreise, beiden letztlich die Arbeitsgrundlage entzog. Dabei traf es Ari Rath zuerst und auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Im April 1989 kaufte die kanadische Aktiengesellschaft Hollinger International das Blatt. Ari Rath hatte zu diesem Zeitpunkt das Pensionsalter erreicht, aber dass die neuen, politisch konservativen Eigentümer ihm tatsächlich unverblümt ins Gesicht sagten, sein „Schatten“ sei zu groß und er müsse das Blatt verlassen, traf ihn wie ein Schlag, zumal er von den alten Arbeitskollegen, die selbst um ihre Stellen fürchteten, keine Unterstützung erhielt: „Der Satz fiel in eine betretene Stille. Keiner der Anwesenden gab auch nur einen Mucks von sich. Ich kann mit Worten kaum beschreiben, wie sehr mich dieses Schweigen verletzte. Es war der vollständige Verrat.“14

Teddy Kollek und Schimon Peres: Visionen vom Frieden bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheitsinteressen des Staates Israel
Foto: Saar Yaacov/Israel Government Press Office
Es zeugt von seinem journalistischen Ethos, von seiner völligen Hingabe an seine große Mission, dass er bis zum letzten Tag in der Redaktion ausharrte, sein letzter Tag eine letzte Reise nach Ma’ale Adumim, wo ein palästinensisches Taxi von militanten Siedlern attackiert worden war, ein letzter Bericht, dann der Abschied. Vielleicht, sagen israelische Freunde, die Ari Rath in dieser Zeit begleitet haben, bedeutete dieser Abbruch seiner Karriere so etwas wie ein Wiedererleben seines Kindheitstraumas: die Vertreibung aus Wien. Die „Jerusalem Post“ war seine Familie, seine Heimat, sein Lebenswerk gewesen, nun stand er von einem Tag auf den anderen ohne Halt da. Selbst wenn er Jahre später von diesem Augenblick erzählt hat, war die Erschütterung noch gut spürbar. Und die tiefe Dankbarkeit, die er für Teddy Kollek verspürte, der ihn in dieser Situation auffing und ihm vorschlug, als Berater für die Jerusalem Foundation zu arbeiten, eine Tätigkeit, die er allerdings bereits nach drei Jahren wieder beendete.
In dieser Zeit zeichnete Ari Rath auch als Herausgeber für ein Album zu Teddy Kolleks achtzigstem Geburtstag – und gleichzeitig seinem 25. Jubiläum als Bürgermeister von Jerusalem 1991. Der Band heißt „Teddy“, das Impressum nennt Ari Rath und Shula Eisner als Herausgeber im Auftrag der Jerusalem International Book Fair und der Bertelsmann-Stiftung. Die Fotografien im Album zeigen Teddy Kollek mit wichtigen Politikern, Kulturschaffenden und Jerusalemer Bürgern: Mit Konrad Adenauer, Richard von Weizsäcker und Jimmy Carter, mit Milan Kundera, Simone de Beauvoir und Arthur Rubinstein, mit Flüstertüte bei einem Meeting in der Altstadt von Jerusalem oder im Gespräch mit einem kleinen arabischen Jungen. Den Text des Albums verfasste Abraham Rabinovich – und er endet mit einem Zitat des Philosophen Isaiah Berlin: „He has earned in large measure the love and respect of all the inhabitants of Jerusalem – he is probably the only man in authority in the city, not the only Israeli or the only Jew, but the only man, whom all – Jew, Arab, Christian – recognize as being benevolent, just, humane, reasonable, above all, a genuinely good man.“
Gut vier Jahre nach Ari Raths Beendigung seiner Tätigkeiten bei der „Jerusalem Post“ endete auch Teddy Kolleks große Zeit als Bürgermeister von Jerusalem. Auch das ein bitterer, aber, wie die Zeitgenossen urteilten, unvermeidbarer Abschied. Im letzten Augenblick hatten sich die ultraorthodoxen Wähler der Agudat-Israel-Partei auf die Seite seines Konkurrenten Ehud Olmert geschlagen. Teddy Kollek, der in Umfragen kurz zuvor noch mit zwei Prozent geführt hatte, verlor mit zehn Prozent Abstand – die palästinensischen Wähler der Stadt waren zuvor von der Hamas bedroht worden – wer zu Wahl gehe, habe mit Konsequenzen zu rechnen, aber es war wohl auch das Alter des 82-jährigen Kandidaten, das ihm zum Verhängnis wurde: „Every great man is entitled to at least one major blunder, and Teddy Kollek is no exception. But his mistake in running for mayor in Jerusalem, after first wisely vowing to retire at the end of his current tenure, was both honest and noble. What prompted him to reverse his decision was not political ambition or a desire for self-aggrandizement, but loyalty to the larger cause of peace; to what he perceives as the good of the country.“ Und weiter: „It was not Ehud Olmert who defeated Kollek yesterday. Neither he nor anyone else could have seriously challenged Teddy a few years ago. Only the inexorable march of time, that ruthless clock which favours no one, could prove a match for this giant among men.“15 So kommentiert die „Jerusalem Post“ am Tag nach der Wahl, dem 3. November 1993, das Ergebnis. Das Titelbild des Tages: ein gebeugter Teddy Kollek, den Kopf gesenkt, so dass die Augen nicht erkennbar sind, auf dem Weg nach Hause, nachdem das Wahlergebnis absehbar war. Und dazu ein Zitat des abgewählten Bürgermeisters: „I am a lion and I will always remain a lion.“
Nein, Löwen werden nicht besiegt, jedenfalls nicht von den äußeren Umständen und das Festhalten, die Hoffnung auf eine gute Zukunft Israels haben sich weder Ari Rath noch Teddy Kollek je nehmen lassen, waren die Aussichten auch noch so widrig. Auch wenn man für Ari Rath sehr wohl sagen muss: Seit Teddy Kollek die Geschicke der Stadt nicht mehr leitete, wurde sie ihm zunehmend fremd. Der „ewig neue Wettstreit um das Seelenheil der orthodoxen Jerusalemer Stadtbevölkerung, der Extremismus und Gewalt erzeugt“,16 stießen ihn ab, der Zuzug vieler Haredim in seine Wohngegend in der Kerem Kayemet Street irritierten ihn: „Es war einfach nicht mehr das Teddy-Kollek-Jerusalem, in dem er sich wohlgefühlt hatte.“ So bringt es Eik Dödtmann auf den Punkt, ein Judaist, der bei Ari Rath in Potsdam einst ein Seminar über die Entwicklung des Staates Israel belegte. Trotzdem hat Ari Rath seine Loyalität mit Israel und Jerusalem nie aufgegeben. Schon als er – nach einer schweren Erkrankung – faktisch die längste Zeit des Jahres wieder in Österreich lebte, nannte er Jerusalem seinen Wohnort. Dass er in der Wiener jüdischen Community wegen seines kritischen Blicks auf Israel heftig angegriffen wurde, hat ihn zutiefst verletzt.
Teddy Kollek hätte seine Heimatstadt wohl nie verlassen. Anders als Ari Rath lebte allerdings auch seine Familie in der Nähe. Bis zuletzt, erinnert sich Osnat Kollek, habe ihr Vater den Blick nach vorne gerichtet, gefragt, wie es ihm gehe, mit Optimismus geantwortet: „Sehr gut.“
Manch einer wird Ari Rath im Januar 2017 noch kurz vor seinem Tod im Wiener AKH erlebt haben: Da lag er, stets umgeben von einer internationalen Besucherschar. Er wusste, wie krank er war und dass er nicht mehr lange leben würde. Trotzdem scherzte er mit den Besuchern, ließ sich täglich über die aktuelle Weltpolitik informieren, feierte noch groß seinen 92. Geburtstag und gab seinen Freunden einen letzten Kampfspruch mit, einen Spruch, wie er jahrzehntelang auch für Teddy Kollek gegolten hatte: „Ich bin ein fighter und mache weiter.“
Am 2. Januar 2007 starb Teddy Kollek in Jerusalem, zehn Jahre und elf Tage später Ari Rath in Wien – Persönlichkeiten, die in ganz einzigartiger Weise Wien und Jerusalem, Israel und Europa zusammenbanden. Ihr Optimismus, ihre Zugewandtheit zur Welt und Humanität wird uns in unserer krisengeschüttelten, von Rechtspopulismus, Antisemitismus und religiösem Dogmatismus bestimmten Gegenwart zunehmend fehlen.
Der Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten im Rahmen des Symposiums „Teddy Kollek. Der Wiener Bürgermeister von Jerusalem“, veranstaltet von der Moses-Mendelssohn-Stiftung, Erlangen in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien im Looshaus, Wien, am 11. April 2018.
1 Ari Rath, Ari heißt Löwe. Erinnerungen. Wien: Zsolnay Verlag, 2012, S. 45.
2 Ebd., S. 102.
3 Mail an Stefanie Oswalt vom 1. April 2018.
4 Teddy Kollek und Amos Kollek, Ein Leben für Jerusalem. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1980; Teddy Kollek, Jerusalem und ich. Memoiren. Frankfurt am Main: Fischer, 1998.
5 Ari Rath, Ari heißt Löwe, S. 28.
6 Ebd., S. 36.
7 Ebd., S. 102.
8 Ebd., S. 102.
9 Ebd., S. 103.
10 Tom Segev, David Ben Gurion. Ein Staat um jeden Preis. München: Siedler Verlag, 2018, S. 14 f.
11 Ari Rath in einem Vortrag („Wiener Vorlesung“) mit dem Titel „Teddy Kollek: Zeitzeuge und Mitgestalter des 20. Jahrhunderts“. Zitiert nach https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/vorlesungen/termine/2011/teddy-kollek-26-5.html
12 Vgl. Rudolf Radtke, Teddy Kollek. Ein Leben für die Menschlichkeit. München: List, 1991, S. 181.
13 Ari Rath, Ari heißt Löwe, S. 258 ff.
14 Ebd., S. 101.
15 Jerusalem Post, Teddy’s defeat, 3. Nov. 1993, S. 2.