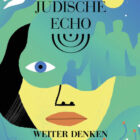„Ich bin keine Feministin“

Von Frauke Steffens
Die ultraorthodoxe Richterin Ruchie Freier hat in New York einen Ambulanzdienst gegründet, der von Frauen betrieben wird.
Ruchie Freier flicht den Teig für das traditionelle Challa-Brot wie einen Zopf. Sie schneidet Kartoffeln, Zwiebeln, stellt den Ofen an. Freier arbeitet schnell, sie will keine Zeit verlieren. Das Abendessen macht sie schon morgens. „So funktioniert es, so kriege ich das alles hin“, sagt die 54-Jährige. Sie lacht viel, spricht schnell, vermittelt den Eindruck schier unendlicher Energie. Klein ist sie, sehr zierlich, sehr elegant. Freier ist oft beim Kochen zu sehen in „93Queen“, einem Film von Paula Eiselt über den Frauen-Rettungsdienst im chassidischen Teil von Brooklyn. Freier hat im streng orthodoxen Stadtteil Borough Park Dinge geschafft, die viele Menschen nicht für möglich hielten. Sie gründete im Jahr 2011 gemeinsam mit anderen Frauen den Rettungsdienst Ezras Nashim, drei Jahre später konnten die Sanitäterinnen die Arbeit aufnehmen. Und seit 2016 ist Freier Richterin in Brooklyn, sie wechselte von Zivilrecht zu Strafsachen.
Für die Filmemacherin Eiselt verkörpert Freier einen feministischen Aufbruch aus den Traditionen der chassidischen Community. Wie sieht sie ihre Rolle selbst?
Es ist nicht leicht, einen Termin bei Richterin Freier zu bekommen. Sie hat ihr Büro im streng bewachten Gerichtshochhaus in Downtown Brooklyn. Unten müssen alle Besucher durch die Sicherheitsschleuse, oben sind die „Chambers“ der Richterinnen und Richter, was sich deutlich alt-ehrwürdiger anhört, als es ist. Kleine Büros sind es, die für New Yorker Verhältnisse aber sehr geräumig sind. Das von Ruchie Freier ist voll mit Andenken, viele Fotos von ihren sechs Kindern und ihrem Ehemann David hat sie aufgestellt. An den Wänden hängen gerahmte Zeitungsartikel über Freier, auch in anderen Sprachen. Auf einer kleinen Kommode stehen Porträts ihrer Urgroßeltern. Sie wurden von den Nazis ermordet. Die Großeltern überlebten den Holocaust und wanderten aus Ungarn in die USA aus. „In meiner Familie lieben wir Amerika, wir sind alle amerikanische Patrioten“, sagt Freier. Auf vielen Fotos ist sie selbst zu sehen – der Stolz ist ihr anzumerken, als sie auf ein Bild von ihrer Examensfeier zeigt.

Die ultraorthodoxe Jüdin Ruchie Freier bei ihrer Angelobung als Richterin in Brooklyn, 2016
© Andre Reichmann
Berühmt wurde Ruchie Freier lange bevor sie die erste chassidische Frau in einem öffentlichen Amt in Amerika war. Die Reporter kamen schon, als sie seit 2011 dafür kämpfte, dass Frauen als Sanitäterinnen anderen Frauen helfen können. „Den meisten Menschen ist das gar nicht klar. Eine Notfallsituation ist oft ein Eingriff in die Intimsphäre, und da sind alle Frauen verletzlich, ob religiös oder nicht“, sagt Freier. „Wenn eine Frau die religiösen Vorschriften befolgen will und ihr ist das wichtig und sie hat das ihr Leben lang getan – dann kann es eben sein, dass nie ein Mann außer ihrem Ehemann auch nur ihr Bein nackt gesehen hat. Und dann stehen mehrere Männer, Sanitäter, in ihrem Zimmer und sie bekommt gleich ein Kind – das bedeutet eine Menge zusätzlichen Stress.“ Religiöse Vorschriften besagen, dass Frauen von fremden Männern nicht berührt werden und ihr Haar nicht unbedeckt zeigen dürfen, wenn sie verheiratet sind. Bei Notfällen gilt das allerdings nicht. Doch weil die Sanitäter vom chassidischen Rettungsdienst Hatzolah Freiwillige aus der ganzen Gemeinde sind, könne auch mal der Nachbar dabei sein, sagt Freier.
Sie erzählt, dass die Chefs von Hatzolah in den 1970er-Jahren sogar Frauen ausbildeten – über 200 in Brooklyn und fast hundert im Norden des Bundesstaates New York, wo es mehrere chassidische Dörfer gibt. Damals planten sie eine 300 Frauen starke Einheit, die sich besonders um Notfälle mit schwangeren Frauen kümmern sollte. Doch am Ende meinten zu viele Männer mit Einfluss, Frauen hätten im Sanitätsdienst nichts zu suchen. Jahrzehnte passierte nichts, bis 2010. „Ich bekam diesen Anruf von den Frauen, die gehört hatten, dass ein mächtiger Rabbi in der Stadt New Square angefangen hatte, Frauen in den Hatzolah-Sanitätsdienst zu integrieren. Und jemand hatte ihnen gesagt, wenn ihr irgendetwas erreichen wollt, nehmt euch einen Anwalt“, erzählt Freier.
New Square ist eine streng orthodoxe Gemeinde im Norden des Staates New York – dass ausgerechnet ein Rabbi dort Sanitäterinnen unterstützte, machte den Frauen Mut. Bald kämpfte Freier mit ihnen gemeinsam für den Segen der Rabbis in Brooklyn. Sie machte selbst eine Hilfssanitäter-Ausbildung und ist bis heute Direktorin des Rettungsdienstes. Heute hat Ezras Nashim eine staatliche Zulassung und über fünfzig lizensierte Sanitäterinnen. Bislang fahren die Frauen mit normalen Autos zu ihren Patientinnen, aber sie sammeln Spenden und wollen bald ihren ersten Krankenwagen kaufen.
Viele in der chassidischen Gemeinschaft waren am Anfang gegen die Frauen in den weißen Kitteln. Auch das zeigt der Film „93Queen“, dessen Name vom Notruf-Code des Rettungsdienstes kommt: Das Auto für die Rettungseinsätze wird eines Tages mit einer Parkkralle lahmgelegt. Ein anonymer Mitarbeiter von Hatzolah sagt mit verfremdeter Stimme, die Aufgabe von Frauen sei es, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen. Und auf der Straße fragt ein Mann: „Warum müssen Sie unbedingt Richterin werden?“ Ruchie Freier bleibt freundlich und entgegnet ihm, sie könne vieles gleichzeitig tun, sie backe ja auch immer noch Challa.
Die Rabbis sind inzwischen längst auf ihrer Seite – nicht alle, aber die meisten. „Ihre Sorge war, dass Frauen in Borough Park sehr beschäftigt sind und dass die Sanitäterinnen vielleicht nicht mehr ihre wichtigste Arbeit machen könnten – und die ist eben die Familie“, sagt Freier im Interview in ihrem Büro. Ähnlich war es mit ihrer Karriere als Richterin. Sie habe dafür keine Regeln brechen müssen. Bislang hatte es nur keine Frau ausprobiert. „Wäre das hier ein rabbinisches Gericht, wäre es ein Problem gewesen“, sagt Freier und lacht. „Aber das ist es eben nicht.“
Eine Mehrheit der rund eine Million Juden in der Stadt New York gibt in Umfragen an, nicht sehr religiös zu leben. Die orthodoxen Chassidim wohnen vor allem in Ruchie Freiers Heimat Borough Park oder in Süd-Williamsburg in Brooklyn. Wer durch diese Stadtteile spaziert, nimmt oft vor allem die Abgeschlossenheit der chassidischen Gemeinschaft wahr. Die Geschäfte haben jiddische Aufschriften in hebräischen Buchstaben, auf der Straße gibt es kaum jemanden, der nicht hierher gehört. Die Männer tragen schwarze Mäntel, Schläfenlocken, je nach Sekte oder Anlass auch Pelzhüte.
Frauen, die verheiratet sind, verbergen ihr Haar unter einer Perücke, manche auch unter einem Kopftuch, das geknotet wird und bis in die Stirn reicht. Die Geburtenrate unter den chassidischen Juden in Borough Park, wo mehr als 100.000 Menschen leben, liegt bei über sechs Kindern pro Frau. Nicht wenige Menschen setzen die orthodoxe Lebensweise mit der Unterdrückung von Frauen gleich. Berichte von Aussteigerinnen scheinen das zu bestätigen – für sie gibt es in New York auch Selbsthilfegruppen. Religion kann in traumatischen Familienkonstellationen wie ein Brandbeschleuniger wirken, überall auf der Welt. Ruchie Freier weiß das – doch sie kämpft gegen die Vereinfachungen. „Es ist mir wichtig, dass die Leute wissen, dass das Judentum Frauen hoch achtet, regelrecht auf ein Podest stellt. Manche Menschen schauen auf die religiösen Regeln und sagen, das ist Diskriminierung, aber so wie ich aufgewachsen bin, erlebe ich es ganz anders.“
Freiers schwarze Perücke ist besonders seidig, fällt wie echtes Haar, das Make-up lässt ihre dunklen Augen strahlen. Ein hochgeschlossenes Kostüm wirkt wie die Antithese zu dem, was in Amerika so häufig als Uniform der berufstätigen Frau gilt: gern eng, gern viel Haut, High Heels sind ein Muss. Ähnlich wie muslimische Frauen verzichten viele Chassidinnen keineswegs auf Eleganz. Sie muss aber vereinbar sein mit der „Modesty“, den Regeln, für die der englische Begriff nur unzureichend übersetzbar scheint. Eine Mischung aus Haltung, Bescheidenheit, Würde soll er bedeuten – „Keuschheit“ sagt man oft auf Deutsch, das klingt etwas abwertend. Weibliche Macht vermittelt sich in Ruchie Freiers Büro gerade nicht über das sonst allgegenwärtige Sexy-Sein, sondern durch eine gelassene, freundliche, ja auch strenge Sachlichkeit. Freier ist die beste Botschafterin, die sich die Orthodoxen in Borough Park wünschen können – irgendwann müssen das auch die strengsten Rabbis erkannt haben.
Amtsrichterin ist in den USA ein Wahlamt. „Ich bin Ruchie Freier, ich kandidiere als Amtsrichterin“, sagt sie zu Passanten im Film „93Queen“. Hinter ihr am Infostand ruft ein junger Wahlkampfhelfer mit Schläfenlocken und Kippa in ein Megafon: „Wählt Ruchie Freier zur Amtsrichterin!“ „Es ist Zeit“, steht auf ihren Aufklebern und Flyern. Als man sie im Dokumentarfilm beim Straßenwahlkampf sieht, ist Ruchie Freier schon seit Jahren Anwältin – und Mutter von drei Töchtern und drei Söhnen. Viele Menschen glauben, dass chassidische Frauen nicht außer Haus arbeiten, doch das stimmt nicht. Oft arbeiten sie sogar ziemlich viel, wenn auch meist nicht in akademischen Berufen. Viele ernähren ein paar Jahre lang allein die Familie, während der Ehemann sich religiösen Studien widmet.
So ist es auch bei Ruchie Freier. Schon in der orthodoxen High School belegt sie einen Kurs in juristischer Stenografie. Mit 19 heiratet sie ihren Ehemann David. Erst arbeitet sie als Sekretärin, Mitte der 1990er-Jahre wird sie Rechtsanwaltsgehilfin in einer Großkanzlei. David Freier studiert in der Zeit in einem Kollel, einer Talmud-Thora-Schule für verheiratete Männer. Als er danach aufs College geht, beschließt Ruchie Freier, auch einen höheren Abschluss machen zu wollen, und schreibt sich am Touro College ein. Mit dreißig fängt sie an, Jus zu studieren. „Wenn ich ein Mann wäre, hätte ich die Hälfte meiner Probleme. Wäre ich ein chassidischer Mann, dann wäre alles leichter für mich“, sagt sie in einer dieser schnellen Küchenszenen im Film, bei denen man eine Ahnung davon bekommt, wie diszipliniert Freier ihren Alltag organisieren muss.
Mit der Dokumentation von Paula Eiselt ist sie zufrieden, zeigt sie doch ein differenziertes Bild von chassidischen Frauen. Nur an einem Punkt sind sich Filmemacherin und Protagonistin nicht ganz einig. Eiselt sieht Freier als Teil eines feministischen Aufbruchs, das suggeriert auch der Tenor mancher Presseberichte über sie: Die Welt der ultraorthodoxen Juden und Jüdinnen erscheint darin ausschließlich dunkel, und die Richterin kämpft gegen diese Dunkelheit.
Aber so will Freier nicht verstanden werden. Alles, was sie tue, tue sie im Einklang mit ihrer Religion, sagt sie: „Feminismus ist ein säkulares Konzept, also lehne ich dieses Label ab. Es bedeutet schließlich, dass Frauen überall die Rolle von Männern übernehmen wollen, auch in der Religion. Doch im Judentum haben Männer und Frauen ihre Aufgaben und Rollen, und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber wenn wir über die Ermächtigung von Frauen reden, über ihre Fähigkeiten und das, was sie damit machen können, dann bin ich an vorderster Stelle dabei.“ Was sie tue, werde für die nächste Generation immer normaler werden – doch jede Frau solle tun, was am besten zu ihr und ihrer Familie passe.
In der Schlussszene des Films „93Queen“ feiert Ruchie Freier ihre Vereidigung am Gericht in Brooklyn. Ihr Mann steht sichtlich gerührt am Rednerpult neben der amerikanischen Flagge und spricht von einem Lebenstraum, der für seine Frau in Erfüllung gehe. Ihre halbwüchsigen Töchter, altmodisch gekleidet, legen der Richterin die schwarze Robe um. Im Publikum applaudieren viele orthodoxe Frauen, eine davon ist Freiers Mutter – sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.
Foto Frauke Steffens © Privat