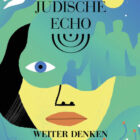Frauen an der Macht?
Von Trautl Brandstaller

Jahrelang kam die Bewegung zur Gleichstellung von Frauen Schritt für Schritt voran. Doch trotz jüngster Erfolge – Stichwort Bundeskanzlerin – bleibt die Bilanz zwiespältig. Sogar alte Männlichkeitsideale leben wieder auf.
Sieht man sich die derzeitige österreichische, aber auch die europäische Politik an, könnte man den Eindruck gewinnen, der Feminismus habe endgültig den Sieg errungen. Die Übergangsregierung in Österreich wird erstmals von einer Bundeskanzlerin angeführt, in ihrer Regierungsriege sitzen fünfzig Prozent Frauen und fünfzig Prozent Männer; auf europäischer Ebene wird für die Spitzenposten intensiv um Geschlechterparität gerungen. Ist in der Frauenpolitik also alles paletti?
Böse Zungen wenden ein, dass es sich hier eher um eine Krise der männlichen Eliten und eine Krise der von diesen männlichen Eliten geführten Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene handelt – eine Krise, in der die Frauen als Nothelferinnen einspringen. Weniger pessimistisch ist durchaus festzustellen, dass die Frauenbewegung der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre große Erfolge erzielt hat, sie hat das gesellschaftliche Bewusstsein radikal verändert. Die traditionellen Rollenklischees sind erodiert. Viele politische Maßnahmen in Österreich haben diesen Wandel, vor allem den Wandel des Frauenbildes, befördert: die Änderung des Familienrechts, mit der Abschaffung des bis 1970 im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) festgeschriebenen Patriarchats, die Erleichterung der Scheidung, die Straffreiheit der Abtreibung (2018 sogar im katholischen Irland durch eine Volksabstimmung erzwungen), die Forderung nach selbstbestimmter Sexualität und – vor allem – der massiv verstärkte Zugang der Mädchen zu höherer Bildung, heute haben die Frauen bei der Akademikerquote mit den Männern gleichgezogen (wenn auch in sehr verschiedenen Disziplinen).
Weniger massiv war die Änderung des männlichen Rollenbildes, hier ist erst in den letzten zwanzig Jahren ein deutlicher Wandel in der jüngeren Männergeneration eingetreten, der allerdings von der Politik bisher kaum wahrgenommen wurde. Männer beginnen sich um Kindererziehung und Haushalt zu kümmern, und wenn auch der Karenzurlaub für Väter nur in einem geringen Ausmaß in Anspruch genommen wird, ist dennoch ein neues Rollenbild im Entstehen.
Backlash nach 1989
Die scheinbare Erfolgsstory des Feminismus weist allerdings eine harte Bruchlinie auf. Wie in vielen anderen Bereichen, vor allem im ökonomischen Bereich, bildet das Jahr 1989 eine klare Zäsur. Die Implosion des Kommunismus und die Wende der westlichen Welt, angeführt von den USA, zum „Neoliberalismus“, der für manche Kommentatoren immer noch nicht existiert, aber im „Washington Consensus“ von 1990 festgeschrieben ist (mit den drei Forderungen nach Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung), blieb nicht ohne Rückwirkung auf die Gesamtstruktur der Gesellschaft. Wenn auch die Auswirkungen primär die Wirtschaft und den Sozialstaat betrafen, so blieben weder die Demokratie noch die Kultur noch die Geschlechterrollen davon unberührt.
Wie so oft sind es die USA, die den neuen Ton in der Geschlechterdebatte angeben, vor allem auf dem Weg über ihre Film- und Fernsehindustrie (das Internetzeitalter steckte noch in den Anfängen). Neue Serien veränderten das Frauenbild – die jungen Frauen waren zwar nicht mehr die „Weibchen“ der Fünfzigerjahre à la Doris Day, sie hatten Bildung und Selbstbewusstsein, aber ihr einziges Ziel blieb die Eroberung eines reichen Mannes, mithilfe von High Heels und attraktivem Dekolleté – bekanntestes Beispiel für das „neue“, modernisierte alte Frauenbild war „Sex and the City“. In der Nachfolge wurden aus den Männerjägerinnen dann „Desperate Housewives“, die sich in ihren Villen am Stadtrand langweilen.
Und während die neue neoliberale Ideologie mit gefälligen Bildern die Frauen wieder aus der Politik und dem öffentlichen Leben drängte, vollzog auch die Frauenbewegung eine fatale Wende. Judith Butler avancierte mit ihrem 1991 erschienenen Werk „Gender Trouble“ (deutsch „Das Unbehagen der Geschlechter“) zur neuen Kultfigur der Bewegung. Ihre radikale These, nicht nur die kulturellen Rollenbilder seien gesellschaftlich geformt, sondern auch die Biologie, der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau sei ein gesellschaftliches Konstrukt, verstörte die Feministinnen alter Schule und verlagerte den Kampf um Gleichberechtigung auf die psychologische Ebene der ambivalenten Identitäten.
Von nun an ging es weder um die Macht in der Demokratie noch um Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, weder um eine Emanzipation beider Geschlechter von ihren alten Rollenklischees noch um die Erringung eines neuen Freiheitsgrades in der Gesellschaft, die Frauenbewegung reduzierte sich auf die Fragen der sexuellen Identität – die Abkürzung LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Intersexual) wurde zur Flagge der neuen Frauenbewegung der 2000er-Jahre.
Die Folgen der neuen Positionierung waren zwiespältig – zum einen gab es sicher eine neue Sensibilisierung für Gewalt gegen Frauen. Die #MeToo-Bewegung brachte – bei aller rechtsstaatlichen Problematik – ein Thema aufs Tapet, das bislang unter den Teppich gekehrt wurde: die alltägliche, in verschiedensten Formen stattfindende Gewalt gegen Frauen.
Zum anderen führte diese Debatte aber auch zu absurden Folgen: In Schweden wurde ein Gesetz beschlossen, wonach der Geschlechtsverkehr nur mit ausdrücklichem Einverständnis beider Partner erfolgen darf, in Frankreich ein Gesetz, wonach Männer Frauen nicht nachpfeifen dürfen. (Die „dollen Minnas“ in den Niederlanden der Siebzigerjahre stellten sich noch reihenweise auf der Straße auf und pfiffen den Männern nach, um diese Art der „Anmache“ lächerlich zu machen.)

Brigitte Bierlein, Österreichs erste Bundeskanzlerin, wurde am 3. Juni 2019 mit der Führung der Übergangsregierung betraut
Solche gesellschaftlichen Entwicklungen lösen keinen Geschlechterkampf, sondern einen Geschlechterkrampf aus – kein Wunder, dass derzeit die Idee kursiert, der beste Sex sei Sex mit einem Roboter. Wenn im intimsten Bereich der Roboter den Menschen ersetzt, sind wir einen großen Schritt weiter in Richtung Dehumanisierung der Gesellschaft.
Verdrängte Sozialfrage
Auf der Strecke bei der „Gender“-Debatte bleiben die massiven sozialen Probleme, die der Neoliberalismus und die von ihm ausgelöste Krise der Weltwirtschaft aufwirft: das Sinken der Reallöhne, die Frauen noch stärker trifft als Männer (sie verdienen ja im Schnitt immer noch fast dreißig Prozent weniger als Männer), das Sparen bei Kindergärten und Ganztagsschulen, der massive Anstieg der Lebenshaltungs- und Wohnkosten, die wachsende Kluft zwischen den wenigen Reichen und den mehr werdenden Armen – für alle diese drastischen Entwicklungen bietet die Debatte um Binnen-I und neuen Text der Bundeshymne keine befriedigende Antwort.
Die realen Sorgen der Frauen und die ideologischen Anliegen der Feministinnen haben sich weit voneinander entfernt.
Ebenso vernachlässigt hat die Frauenbewegung das Thema der Zuwanderung, vor allem der türkischen Frauen und der Frauen aus dem arabischen Raum. Hier nur nach einem „Kopftuchverbot“ zu schreien, greift zu kurz. Es kann nur die Sache der Frauen selbst sein, sich zu emanzipieren – natürlich unterstützt von engagierten Frauen der hiesigen Frauenszene. Unterstützte Emanzipation ist ein mühsamer, langwieriger Prozess und keine Frage von Verboten und Strafen.
Der Rechtsruck in den europäischen Gesellschaften, ausgelöst durch die neoliberale Orientierung der Wirtschaft mit ihren katastrophalen sozialen Folgen, drängt auch die Frauenpolitik nach rechts: Rückkehr zum traditionellen Frauenbild, zur traditionellen Frauenrolle, Kürzung der Mittel für Fraueninitiativen, Wiederaufleben der alten Männlichkeitsideale von Krieg und Heldentum.
Globalisierte Frauenbewegung
Dies ist allerdings der westliche Blick auf die Geschlechterverhältnisse. Die Frauenbewegung hat sich längst globalisiert und auf den anderen Kontinenten, vor allem in Afrika und Asien, enorme politische Bedeutung gewonnen.
In weiten Teilen der Welt kämpfen Frauen noch immer um ihr Überleben: In China wurden mit der jahrzehntelang betriebenen Ein-Kind-Politik massiv weibliche Föten abgetrieben, in Indien ist die Tötung weiblicher Föten immer noch gang und gäbe. Indische Feministinnen haben ihren Kampf erst begonnen.
Weltweit haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten Protestbewegungen von Frauen formiert. Die Klitoris-Beschneidung in Afrika ist ein immer noch praktizierter Gewaltakt gegen Frauen – hier hat sich in Europa eine breite Frauenprotestbewegung gegen „genitale Verstümmelung“ formiert, die von afrikanischen Frauen initiiert wurde. In den arabischen Ländern ist der Widerstand gegen gleiche Rechte für Frauen besonders ausgeprägt. Der – kurze – Arabische Frühling wurde ganz wesentlich von jungen Frauen getragen. Erst jüngst haben sich Frauen in Saudi-Arabien das Recht aufs Chauffieren eines Autos erkämpft.
Dass die Religion – vom Judentum über das Christentum bis zum heute aktuellen Islam – das Thema Sexualität, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, die Rolle der Frau in der Gesellschaft massiv prägt, wäre eine eigene Analyse wert. Tatsache ist, dass sich die Frauenbewegung in allen Phasen und in allen Kulturen gegen den ausgeprägten Patriarchalismus der monotheistischen Kulturen entwickelte und weiter entwickelt.
Bei allen politischen Rückschlägen und kulturellen Schwierigkeiten: „Es gibt ein gemeinsames Ziel aller dieser feministischen Aktivitäten: die Schaffung einer Welt, in der ein gutes Leben für alle, ein gleiches, gerechtes und solidarisches Leben für alle, Männer und Frauen, möglich ist“ (zitiert aus der „Furche“, 23. August 2018).
Trautl Brandstaller
Foto: privat