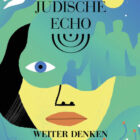Ein Besuch ist nicht möglich … von Gerhard Baumgartner
Für viele Roma und Sinti hörten Verfolgung und Diskriminierung, zur Schande Europas, nach 1989 nicht auf. Auch der an ihnen verübte Holocaust in der Zeit des Nationalsozialismus ist weit davon entfernt, allgemein anerkannt zu sein. Der neue wissenschaftliche Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes hat die Ermordung von 5007 österreichischen Roma und Sinti im „Zigeunerlager“ des Ghettos Łódź/Litzmannstadt dokumentiert.
Im Herbst des Jahres 1941 wurde im Ghetto Litzmannstadt ein sogenanntes „Zigeunerlager“ errichtet, indem man fünf Wohnhäuser mit einem Stacheldrahtzaun umgab und rundherum einen kleinen Graben ausheben ließ. Im Ghetto Litzmannstadt – in der heutigen Stadt Łódź in Polen – lebten damals schon über 120.000 Juden auf engstem Raum, meist polnische Juden aus Łódź und Umgebung, sowie zehntausende deutsche Juden aus Berlin, Köln, Düsseldorf und auch aus Luxemburg. Im Sommer 1941 wurden auch aus Wien 5000 Juden in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Außerdem sollten, laut einer Anordnung Himmlers, auch 5000 österreichische Roma und Sinti in dieses Ghetto deportiert werden.
Die erste Massendeportation von österreichischen Roma und Sinti – in ein jüdisches Ghetto – blieb der zeitgeschichtlichen Forschung für viele Jahrzehnte ein Rätsel und das Schicksal der Betroffenen ist bis heute leider nur sehr lückenhaft dokumentiert. Selbst die Namen der meisten der betroffenen Opfer sind bis heute unbekannt.
Der Großteil der Deportierten kam aus dem heutigen Burgenland, wo vor 1938 rund 9000 Roma und Sinti gelebt hatten. Die illegale NSDAP hatte vor dem „Anschluss“ 1938 bereits einen erbarmungslosen Propagandafeldzug gegen die sogenannten „Zigeuner“ gestartet. Und der burgenländische Gauleiter Tobias Portschy forderte in einer Denkschrift zur sogenannten „Zigeunerfrage“ ihre sofortige Deportation und Inhaftierung in Arbeitslager.
Die burgenländischen Roma und Sinti waren in der Regel keine Fahrenden, sondern seit Jahrhunderten sesshaft. Sie lebten in 130 sogenannten „Zigeunersiedlungen“ – meist am Rand von Dörfern – und verdienten sich im Sommer ihren Unterhalt als landwirtschaftliche Hilfsarbeiter und im Winter durch verschiedene Wandergewerbe, etwa als Kesselflicker, Messerschleifer oder Musiker. In Zuge der Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit strömten jedoch tausende sogenannte „ausgesteuerte“ Arbeitslose aus den Großstädten zurück in ihre burgenländischen Heimatdörfer und verdrängten die Roma und Sinti vom lokalen Arbeitsmarkt.
Die burgenländischen Roma verarmten und verelendeten zusehends. Da die Armenfürsorge damals den politischen Heimatgemeinden der Betroffenen oblag, führte dies zu einer hohen finanziellen Belastung der burgenländischen Dörfer – und natürlich zu einem rasanten Anstieg der Ressentiments gegen Roma und Sinti. Die rassistischen Parolen der Nationalsozialisten fielen hier auf fruchtbaren Boden.
Die Verfolgung der österreichischen „Zigeuner“ eskalierte sofort nach dem „Anschluss“. Bis Juni 1938 wurden 232 von ihnen inhaftiert und in ein Konzentrationslager gesperrt. Ein Jahr darauf ordnete das Berliner Reichskriminalpolizeiamt die Einweisung von 3000 arbeitsfähigen Männern und Frauen aus der Gruppe der burgenländischen „Zigeuner“ in die Konzentrationslager an. Himmler benötigte arbeitsfähige Häftlinge zum Aufbau der SS-eigenen Industrie. Insbesondere bei der Verhaftungsaktion vom Juni 1939 war man in Berlin davon ausgegangen, die burgenländischen Roma würden nicht arbeiten, sondern allein von der Fürsorge leben.
Das Gegenteil war der Fall. Infolge der kriegsvorbereitenden Rüstungskonjunktur hatten viele Roma nun Arbeit in Industriebetrieben, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft gefunden. Sogar der steirische Gauleiter Sigfried Uiberreither äußerte Kritik an den „Zigeunerdeportationen“, denn bei den Verhaftungsaktionen von Arbeitsfähigen blieben viele hundert unversorgte Kinder und ältere Angehörige zurück. Das hatte zur Folge, dass die Fürsorgeausgaben der Gemeinden weiter anstiegen, was abermals als Beleg für die angebliche Asozialität der „Zigeuner“ diente und die Forderung nach ihrer „Abschaffung“ verstärkte.
Seit dem Kriegsbeginn im Herbst 1939 verschärfte sich die deutsche „Zigeunerpolitik“ zusehends. Als Vorbereitung für die geplante „Aussiedlung“ der Roma und Sinti wurden auf Anordnung des Berliner Reichssicherheitshauptamtes regionale Sammellager eingerichtet „um den Unterhalt der Familien sicherzustellen und die Gemeinden nach Möglichkeit von den bisherigen sozialen Lasten zu befreien“.
Als wichtigstes dieser Lager wurde am 23. November 1940 das „Zigeuneranhaltelager“ im burgenländischen Lackenbach errichtet. Die Lagerleitung unterstand der Kriminalpolizeileitstelle Wien, die Kosten des Lagers teilten sich die Landräte der Kreise Bruck an der Leitha, Eisenstadt, Lilienfeld, Oberpullendorf, St. Pölten und Wiener Neustadt sowie die Gemeindeverwaltung des Reichsgaues Wien im Verhältnis der aus den Kreisen und Städten eingelieferten Zahl der Häftlinge. Die festgehaltenen Roma und Sinti mussten unter primitivsten Bedingungen in den Ställen und Scheunen eines ehemaligen Gutshofes leben. Am 1. November 1941 erreichte die Zahl der Inhaftierten den Höchststand von 2335 Personen.
Von der am 1. Oktober 1941 angeordneten Deportation von 5000 Roma und Sinti aus Österreich in das Ghetto von Łódź/Litzmannstadt waren vor allem Burgenland-Roma betroffen. In der Regel wurden ganze Familien deportiert. Darüber hinaus dürfte die Arbeits(un) fähigkeit wichtigstes Selektionskriterium gewesen sein. Die Gemeinden wollten Fürsorgekosten einsparen und nur jene in den örtlichen „Zigeunerlagern“ behalten, die nutzbringend eingesetzt werden konnten. Zwischen dem 4. und 8. November 1941 fuhr täglich ein Zug mit tausend Opfern nach Litzmannstadt. Allein aus Lackenbach wurden 2000 Roma und Sinti deportiert. Die Transporte wurden von je einem Offizier und zwanzig Wachmännern des Reserve-Polizei-Bataillons 172 begleitet. Die Kosten der Deportation bestritten das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und die lokalen Fürsorgestellen gemeinsam.
Von den insgesamt 5007 nach Łódź Deportierten waren 1130 Männer und 1188 Frauen. Neben den 2318 Erwachsenen erfassten die Transporte 2689 Kinder. 613 Personen starben bereits in den ersten Wochen nach der Ankunft im „Zigeunerlager“, die meisten wahrscheinlich an einer Fleckfieberepidemie. Die Übrigen wurden im Dezember 1941 oder Jänner 1942 in das Vernichtungslager Chełmno/Kulmhof überstellt und dort mit Gas getötet. Niemand überlebte.
Bislang war es der Forschung kaum möglich gewesen, die Opfer der Deportation namentlich zu identifizieren, da noch keine Deportationslisten der burgenländischen Roma und Sinti gefunden werden konnten. Aufgrund neuerer Forschungen lassen sich heute zumindest einzelne Gruppen der Opfer eingrenzen.
Zum Teil handelte es sich dabei um steirische und burgenländische Roma, die seit 1940 in Zwangsarbeitslagern des Gaues Steiermark inhaftiert gewesen waren und dort bei Großbauprojekten als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Von den insgesamt 597 in der Obersteiermark in Zwangsarbeitslagern inhaftierten Roma und Sinti wurden im November 1941 insgesamt 327 in das Sammellager Dietersdorf bei Fürstenfeld in der Oststeiermark gebracht. Von dort wurden sie zusammen mit Roma aus den südburgenländischen Bezirken Jennersdorf und Güssing am 5. November 1941 in einem Sammeltransport von insgesamt 1004 Personen in das Ghetto in Litzmannstadt deportiert.
Da zum Sammellager Dietersdorf keinerlei Aktenbestände erhalten geblieben sind, konnten bislang nur einzelne Opfer dieser Deportation aufgrund von persönlichen Mitteilungen von Zeitzeugen und Holocaust-Überlebenden namentlich identifiziert werden. Für das Zwangsarbeitslager in Kobenz bei Knittelfeld, aus dem ein Teil der deportierten Roma mit der Eisenbahn nach Dietersdorf gebracht wurde, konnten Historiker Gefangenenlisten mit den Personaldaten burgenländischer Roma sicherstellen.
„Die Kriminalpolizeistelle Graz ordnete 1942 an, alle Anfragen Angehöriger der Deportierten mit dem Hinweis abzulehnen, dass es bei den ,Umgesiedelten‘ keine Besuchserlaubnis gäbe.“
Ein Teil der aus dem „Zigeunerlager Lackenbach“ nach Łódź deportierten österreichischen Roma und Sinti war erst wenige Tage zuvor mit einem Transport aus dem westösterreichischen Lager Weyer bei St. Pantaleon nach Lackenbach überstellt worden. Der akribischen Arbeit des Historikers und Schriftstellers Ludwig Laher ist es zu verdanken, dass heute alle ehemaligen Insassen des Lagers Weyer namentlich identifiziert werden können. Dabei handelte es sich um die Mitglieder großer westösterreichischer Sintifamilien, wie etwa der Familie Rosenfels aus der Innviertler Gemeinde Weng und den umliegenden Orten, insgesamt 31 Personen, die allesamt in Łódź ermordet worden sein dürften. Identifiziert werden konnte auch ein Teil jener 65 Angehörigen von Kärntner Sintifamilien, die im Oktober 1941 aus Klagenfurt und Villach nach Lackenbach überstellt und von dort zum Teil nach Łódź deportiert wurden. 32 von ihnen hat ihre Heimatstadt Villach im Jahre 1995 auf Betreiben des Lokalhistorikers Hans Haider ein Denkmal gesetzt.
Bei der namentlichen Identifizierung der Deportationsopfer aus dem Burgenland stößt die Forschung bislang auf die größten Probleme. Die zu deportierenden Menschen wurden nach dem Kriterium der Arbeitsunfähigkeit ausgewählt, jene, die „nicht der Fürsorge zur Last“ fielen, konnten bleiben, die anderen wurden deportiert. In diesem Zusammenhang kommt den Listen, die Peter Hinterlechner, Landrat in Oberwart, im Sommer 1939 zusammenstellte, besondere Bedeutung zu. Da Hinterlechner im August in erster Linie unversorgte Frauen und Kinder auflisten ließ, und da im Herbst 1941 vorrangig jene „Zigeuner“ deportiert wurden, die angeblich der Fürsorge besonders zur Last gefallen waren, liegt der Schluss nahe, dass Hinterlechner bei der Zusammenstellung der Litzmannstadt-Transporte im Bezirk Oberwart genau auf diese Listen zurückgriff. Das würde auch die große Zahl von Kindern auf diesem Transport erklären. Einzelne, näher überprüfbare Einzelfälle erhärten diese Annahme.
Im Falle der Familie Pfeiffer aus Markt Allhau (Pauline Pfeiffer, geb. am 4.2.1901 und ihre Söhne Franz, geb. am 6.3.1923, Otto, geb. am 10.6.1930 sowie Johann, geb. am 11.9.1932) wird deutlich, dass zumindest in den Orten Markt Allhau und Buchschachen diese Liste als Ausgangsbasis für den Transport nach Litzmannstadt benutzt wurde.
Ladislaus Pfeiffer, geb. am 9.6.1925 in Kitzladen, überlebte als einziger Sohn dieser Familie, weil er seit seinem 14. Lebensjahr bei einer Baufirma beschäftigt war. Auch sein Vater, der bereits in Juni 1938 nach Dachau verschleppte Josef Pfeiffer, geb. am 5.5.1901, überlebte die Konzentrationslager. Seine Frau und seine übrigen Kinder wurden im November 1941 von Markt Allhau in ein Sammellager nach Sinnersdorf an der steirisch-burgenländischen Grenze gebracht. Ähnlich wie im Falle des ehemaligen Reichsarbeitsdienstlagers Dietersdorf, das als Sammellager für den Transport aus Fürstenfeld diente, dürfte das Reichsarbeitsdienstlager Sinnersdorf als Sammellager für einen Transport aus dem Bezirk Oberwart gedient haben.
Im März 1942 ordnetet die Kriminalpolizeistelle Graz an, alle Anfragen besorgter Angehöriger über das Schicksal der Deportierten an das Reichssicherheitshauptamt weiterzuleiten beziehungsweise mit dem Hinweis abzulehnen, dass es im Falle für die nach Litzmannstadt „Umgesiedelten“ keine Besuchserlaubnis gäbe. Zu diesem Zeitpunkt waren alle dorthin deportierten österreichischen Roma und Sinti bereits tot. So entstand die tragische Situation, dass die in den Jahren 1938 und 1939 in die Konzentrationslager und Zwangsarbeitslager Deportierten, falls sie überlebten und zurückkehrten, feststellen mussten, dass ihre zu Hause zurückgebliebenen Gatten und Kinder sämtlich ermordet worden waren.
In Łódź erinnert seit wenigen Jahren eine kleine Gedenkstätte an das Schicksal der Opfer des ehemaligen „Zigeunerlagers Litzmannstadt“ und 2015 soll auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Chełmno/ Kulmhof ein Gedenkstein für die dort ermordeten 4400 österreichischen Roma und Sinti errichtet werden.
Gerhard Baumgartner Foto: Michaela Bobas-Pupic