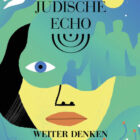Die ewige Schickse von Tessa Szyszkowitz
 Wie sie spät, aber doch bemerkte, dass sie „kulturelle Mutanten“ in die Welt gesetzt hätte, schildert die Autorin, die – als Österreicherin ohne Bekenntnis – in Israel zum Judentum übergetreten ist.
Wie sie spät, aber doch bemerkte, dass sie „kulturelle Mutanten“ in die Welt gesetzt hätte, schildert die Autorin, die – als Österreicherin ohne Bekenntnis – in Israel zum Judentum übergetreten ist.
Paul, unser Zahnarzt auf der Highstreet in St. John’s Wood in London, hatte Augen und Hände in Adams Mund versenkt, unterhielt sich aber weiter mit mir. „Du bist wegen deinem Mann übergetreten, obwohl du Atheistin bist?“, fragte er ungläubig. Paul ist Jude und hat eine nichtjüdische Französin zur Frau. Konvertieren hält er wie viele liberale britische Juden für Hardcore, seine Frau hätte da nicht mitgemacht. „Ja“, sagte ich. „Warum?“, fragte er. „Aus Liebe und historischer Höflichkeit“, antwortete ich. „Und was sind dann deine Kinder?“, forschte er. Adam lag flach auf dem Rücken, während Paul ihm einen Zahn füllte. Der Unterhaltung hörte das Kind, damals acht Jahre alt, mit offenem Mund und hin und her wandernden Augen zu. „Jüdische Atheisten“, sagte ich.
Adam setzte sich ruckartig auf. Paul zog schnell seine Geräte aus Adams Mund. „Wir sind jüdische Atheisten? Mama!“, rief Adam vorwurfsvoll: „Das hast du mir nie gesagt!“
Ich war ungefähr so erstaunt wie mein Sohn. Er hatte völlig recht. So genau hatte ich es weder für meine Kinder noch für mich je definiert. Juden sind sie sowieso und bisher ist Gott für sie ein Fremdwort. Aber ob das immer so bleibt?
Nicht nur meine Familie war völlig überraschend über mich gekommen. Ich hatte nie über Kinder nachgedacht, bis mein Mann unbedingt eines wollte. Ich war 1994 als Nahost-Korrespondentin nach Jerusalem gezogen. Eine Österreicherin ohne Bekenntnis. Ich reiste zwischen Jerusalem, Tel Aviv, Damaskus, Kairo und Beirut herum, verstand mich mit allen gut, die keine Rassisten waren, und machte mir keine großen Gedanken darüber, welche Identität meine Kinder haben würden.
Erst Jahre später, als die Kinder aufwuchsen, kam ich drauf, dass ich kulturelle Mutanten in die Welt gesetzt hatte.
Zum Judentum kam ich natürlich nicht wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte schon in Wien jüdische Freunde, mein Weg nach Jerusalem kam nicht von ungefähr.
Als mein späterer Mann Jonathan seinen Eltern im chinesischen Restaurant in Westjerusalem eröffnete, dass er eine nichtjüdische Frau heiraten wollte, schluckten sie schwer. Einerseits war es ihnen schon egal, wen er heiraten würde, solange er es endlich tat. Seine Mutter fürchtete bereits die längste Zeit, dass er ein Ladenhüter werden würde. Aber eine Schickse aus Wien als Schwiegertochter, das war die Ursünde.
Meine spätere Schwiegermutter, Vita Kollek, geborene Misroch, stammte aus Riga. Ihre erste Sprache war Deutsch, die zweite Englisch, die dritte Russisch. Die vierte, Lettisch, lernte sie nicht mehr, weil die Nazis 1940 die Stadt besetzten. Über Moskau flüchteten die Misrochs nach Palästina.
Der Weihnukka-Baum – in Wien gar nicht so selten.
(Foto: Bodo Marks /dpa/picturedesk.com)
Drei Tage nach dem Mittagessen beim Chinesen in Jerusalem rief mich mein Schwiegervater an und bat mich zum Tee ins Laromme-Hotel, wo er am späten Vormittag immer Station machte, um eine Zigarre zu rauchen. Mir schwante Übles.
Das Laromme-Hotel in Jerusalem, wo der künftige Schwiegervater gern seine Vormittagszigarre rauchte.
(Foto: www.castlesil.com)
Mein späterer Schwiegervater schätzte mich an sich von Beginn an sehr, weil er mir endlich die altmodischen Graf-Rudi- und Graf-Bobby-Witze erzählen konnte, die er noch aus seiner Jugend in Wien kannte. Er war mit seinem Bruder 1935 nach Palästina ausgewandert. Witze auf Deutsch waren bis zu meinem Eintritt in die Familie Kollek kaum mehr erzählt worden. Sie waren gewissermaßen zum Kollateralschaden des Zweiten Weltkriegs geworden. Jene, die diese Witze geliebt hatten, waren entweder vergast worden oder nach Israel emigriert, wo man Witze auf Deutsch nach dem Krieg nicht mehr erzählen mochte. Auch seinen Söhnen hat mein Schwiegervater Paul keine Graf-Rudi-Witze erzählt.
„Ich klopfte Paul beruhigend auf sein Sakko, das er auch bei glühender Hitze trug – inklusive Stecktuch: „Ich könnte ja übertreten“, meinte ich leichthin und hatte keine Ahnung, was ich da sagte.“
Er rauchte seine Zigarre und nach einigem wohlerzogenen Smalltalk kam er zur Sache: „Für meine Frau, musst du wissen, wäre es sehr schlimm, wenn die Kinder nicht jüdisch wären.“ Ich empfand keine Lust, die jüdische Linie der Familie Kollek harsch zu beenden – ich bin ja nicht mein Großvater Willibald, der einst in Danzig vermutlich dafür gewesen wäre, alle jüdischen Familiengeschichten zu beenden. Deshalb klopfte ich Paul beruhigend auf sein Sakko, das er auch bei glühender Hitze immer trug – inklusive Stecktuch: „Ich könnte ja übertreten“, sagte ich leichthin und hatte keine Ahnung, was ich da sagte.
Am Ende einer endlos dauernden Prozedur musste ich in einem Schwimmbecken stehen und Gebete runterratschen, von denen ich kein Wort glaubte. Doch ich hatte viel über jüdische Kultur und Tradition gelernt, dagegen war nichts einzuwenden. Die ganze Familie Kollek kam zu mir, um sich Tipps zu holen, wie lange man warten müsste, bis man nach einem Rindsschnitzel einen Kaffee mit Milch trinken durfte. Sie taten das nicht, weil sie den koscheren Speisegesetzen folgen wollten. Sie fanden es nur so lustig, dass ausgerechnet ich Kaschrut-Regeln rezitieren konnte, die sie für jüdischen Schwachsinn hielten.
So wuchsen meine drei Kinder in einem gottlosen, aber jüdischen Haus auf. Ich hatte nur eine Bedingung gemacht: Weihnachten würden wir immer bei meiner Familie in Wien feiern. Da im Hause meiner Eltern ebenfalls kein Gott wohnte und der Weihnachtsbaum als Schokoanhänger-Ständer diente, erwies sich diese Bedingung als klug: Die Kinder fühlten sich als Juden, was ihrem Vater und seiner Familie wichtig war. Sie glaubten nicht an Gott, was mir und meinen Eltern zentral für ihre Erziehung erschien. Und sie haben gelernt, alle Feste gut zu finden, solange es viel zu essen gibt und Witze erzählt werden.
Nach einigen Jahren aber fiel mir auf, dass unser Patchwork-Kultur-Experiment auch national gesehen nicht ganz einfach war. Unsere Kinder sind dem Pass nach Österreicher und Israelis. Sie haben aber weder in Israel noch in Österreich länger gelebt. Was ich aus meiner Kindheit an Traditionen mitgenommen habe, kennen sie nur aus Ferienaufenthalten. Ihre Muttersprache, mein Deutsch mit der Wiener Färbung, haben sie allerdings von mir bekommen. Und sie können Schnitzel panieren wie sonst nur der Figlmüller.
„Meine Mutter hat sich, als sie in den Fünfzigerjahren erwachsen wurde, sehr hart mit der Geschichte ihrer Eltern auseinandergesetzt. Meine Brüder und ich wurden ebenfalls so erzogen. Bei uns gab es kein Schweigen über den Krieg. Die Fakten lagen auf dem Tisch.“
Die beiden Älteren sind in Jerusalem geboren worden. Mein Sohn Adam kam wie sein Großvater Paul in Wien zur Welt. Der eine 1922, der andere 2004. 1922 war Wien eine multikulturelle, intellektuell herausfordernde Metropole. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist Wien eine kleine, aber feine Stadt, in der selbstvergessen und stur immer noch im Kaffeehaus geraucht werden darf. Dazwischen aber war Österreich mit Lust und Wonne Teil des „Dritten Reichs“ geworden. Wie konnten sich die Wiener in diesen Abgrund der Unzivilisiertheit stürzen? Nicht nur Kinder können dies heute nur schwer begreifen.
Es ist für alle Eltern schwierig – jüdische wie nichtjüdische –, den Kindern zu erklären, dass die Nazis versucht haben, die Juden zu ermorden, einfach weil sie Juden waren. In meinem Fall war es eine harte Übung. Wie erklärt man einem Kind, dass der eine Großvater den anderen Großvater umbringen wollte? Nicht buchstäblich natürlich, sie kannten sich ja nicht. Doch wir hatten die Juden und Antisemiten in der eigenen Familie. Die Kinder mussten sich fragen, zu wem sie gehörten: zu den Opfern oder zu den Tätern?
Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Österreicher und ihre Familien waren keine Widerstandskämpfer. Nicht alle waren in der NSDAP, aber die meisten. Mein Großvater mütterlicherseits war Justizsenator in Danzig, bis er 1944 zu Weihnachten an Krebs starb. Dieser Willibald Wiers-Keiser unterzeichnete die Rassengesetze des Deutschen Reiches für die Freistadt Danzig.
Meine Mutter hat sich, als sie in den Fünfzigerjahren erwachsen wurde, sehr hart mit der Geschichte ihrer Eltern auseinandergesetzt. Meine Brüder und ich wurden ebenfalls so erzogen. Bei uns gab es kein Schweigen über den Krieg. Die Fakten lagen auf dem Tisch.
Auch mein Vater hatte jedes Detail seiner eigenen Familiengeschichte recherchiert. Die Szyszkowitz und Tagger, die Familien seines Vaters und seiner Mutter, lebten beim „Anschluss“ 1938 in Graz. Dort übernahmen die Nazis schon im Februar die Regierung. Auf den Schwarzweißfilmen, die auf unseren Familienfesten gezeigt wurden, sah man so manches Familienmitglied mit einem NSDAP-Abzeichen im Knopfloch herumspazieren.
Die Scham meiner Eltern über die politischen Irrtümer ihrer Eltern hat sich in tiefem Misstrauen gegen Massenbewegungen und gegen absolutistische Ideologien niedergeschlagen. Der – mutmaßliche – Rassismus ihrer Eltern ist bei ihnen in Weltoffenheit und Liberalität umgeschlagen.
Ihr politisches Erbe ging von mir auf meine Kinder über. Meine Söhne und meine Tochter gingen in Brüssel, Moskau und London in die Schule und wuchsen mit den Enkeln der Alliierten auf. In Wien hätten sie vielleicht in der Schule gelernt, dass im „Dritten Reich“ sehr viele Deutsche und Österreicher Nazis gewesen waren und wie man mit der Verantwortung für ihre Verbrechen in späteren Generationen umgeht. Schließlich hatten die meisten Familien Nazis im Stammbaum.
Graf Bobby (Peter Alexander, re.), Freund Mucki (Gunther Philipp) im Film.
(Foto: www.cinefacts.de)
Die Lehrerinnen und Lehrer meiner Kinder aber waren Amerikaner, Russen, Belgier oder Engländer. Heute werden Deutsche – oder Österreicher – natürlich längst nicht mehr mit Nazis gleichgesetzt. Doch das Bild, das meine Kinder von Deutschen in der Schule mitbekamen, war jenes der „anderen“, jener, die auf der bösen Seite der Weltgeschichte gestanden hatten.
Wenn meine Kinder mich fragen, auf welcher Seite sie stehen, sagte ich ihnen, dass es diese Seiten, die Fronten und den Schützengraben dazwischen nicht mehr gibt. Deutschland und Österreich sind heute Länder, die – trotz all ihrer Fehler und der FPÖ – zur demokratischen Zone der Welt gehören. Die Juden werden von der Verfassung und einem gesellschaftlichen Konsens geschützt. Antisemitismus ist nicht mehr salonfähig.
Nicht nur in Österreich. Zwischen Moskau, Jerusalem, Wien und London – jenen Städten, in denen meine Kinder dank meiner Wanderungen heute zu Hause sind – werden Juden nicht von den Regierungen verfolgt. Wenn heute antisemitische Anschläge verübt werden, stehen in der Koalition derer, die rassistische Übergriffe bekämpfen, Nichtjuden und Juden zusammen.
Bei uns zu Hause gibt so etwas wie eine antirassistische Internationale. Meine Kinder wachsen mit meinen Freunden auf, die uns in den verschiedenen Stationen unserer Reisen zugewachsen sind. Bei uns sitzen Briten, Palästinenser, Russen, Israelis und Österreicher gemeinsam am Tisch. Juden, Moslems, Christen treffen sich da und meistens sind all diese Menschen obendrein gottlose Gesellen.
Als ich mich vor ein paar Jahren scheiden ließ, fragten mich viele, ob ich jetzt auch aufhören würde, Jüdin zu sein. Ich wunderte mich, ich hatte mich immer eher als ewige Schickse gesehen. Man kann nicht einfach so in eine Tradition übertreten, die bereits 3000 Jahre währt. Das habe ich auch meinen Kindern zu vermitteln versucht, die sich heute aus verschiedenen Kulturen, Religionen und Religionslosigkeiten, Pässen und Nationalitäten eine ganz eigene Identität geschaffen haben. Der große Fehler der Rassisten und Nationalisten ist ja von jeher, das Mischmasch und das Chaos zu fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Dabei ist es der große kulturelle Eintopf, der Städte zu spannenden Metropolen macht. Bei Menschen ist es ebenso.
Was meine drei kulturellen Mutanten mit ihrem Leben noch anstellen werden, wissen wir natürlich nicht. Als jüdische Atheisten und Londoner mit Wurzeln in Wien und Jerusalem steht ihnen jedenfalls die Welt offen und sie machen bisher keine Anstalten, sich ihr zu verschließen. Unser Vermächtnis ist aber natürlich auch nicht unkompliziert. Die Geister unserer Vergangenheit sind nur noch Schatten ihrer selbst, doch wer weiß, womit sich die nächste Generation herumschlagen wird müssen.
„Graf Bobby sitzt im Kaffeehaus. Es ist November 1918 und er trinkt Ersatzkaffee. „Das versteh ich nicht! So eine schöne Armee hamma ghabt. Husaren, Dragoner, die Prachtrösser“, sagt er.“
Großvater Paul kam am Ende seines Lebens jedenfalls sehr gerne nach Wien. Dann saß er bei uns im Garten und erzählte seine Lieblingswitze, die seit knapp hundert Jahren hier niemand mehr gehört hat. Etwa diesen hier:
Der Graf Bobby sitzt im Kaffeehaus. Es ist November 1918 und er muss Ersatzkaffee trinken. Er ist aber noch aus einem anderen Grund unzufrieden mit der Welt. „Das versteh ich nicht! So eine schöne Armee hamma ghabt. Husaren, Dragoner, die Prachtrösser! Helme! Federbusch! Fahnen mit schönen Stickereien. Die Kaiserjäger, die Deutschmeister! Und die Blasmusik! Da kann man sagen, was man will, das war die schönste Armee der Welt! Und was habens gmacht mit dera Armee? In den Krieg haben sie s’ gschickt!“
Zum letzten Mal kam Paul hierher zur Beschneidung seines Enkels Adam Paul im Sommer 2004. Der Rabbiner sang und wir alle tanzten Hora im Garten meiner Eltern. Adolf Hitler würde im Grab rotieren, wenn er eins hätte. Und das ist gut so.
- Tessa Szyszkowitz (Foto: privat)