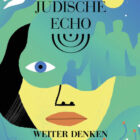„Bleiben oder gehen“ von Alexia Weiss
 Wenn der antisemitisch motivierte Terror wieder einmal näher rückt, macht man sich auch in Wien Sorgen um die Sicherheit der jüdischen Gemeinde. Sind sie begründet? Oder wird allzu rasch vor einem erstarkenden Antisemitismus gewarnt? Eine Betrachtung.
Wenn der antisemitisch motivierte Terror wieder einmal näher rückt, macht man sich auch in Wien Sorgen um die Sicherheit der jüdischen Gemeinde. Sind sie begründet? Oder wird allzu rasch vor einem erstarkenden Antisemitismus gewarnt? Eine Betrachtung.
Antisemitische Übergriffe nehmen in Europa überhand: kaum ein Tag, an dem man in jüdischen Medien keine Nachricht erhält, dass hier ein Jude auf der Straße angepöbelt, dort ein Gebäude beschmiert wurde. Manches Mal ist auch von tätlichen Übergriffen die Rede: in Frankreich etwa.
Sommer 2014: Vor einem Jahr wehrte sich Israel gegen die Terrorangriffe aus Gaza. Wie immer, wenn sich Israel in einer kriegerischen Auseinandersetzung befindet, schwappt etwas über. Israel-kritische bis -feindliche Kundgebungen förderten auch so manchen antisemitischen Kampfruf zutage. In Berlin. In Paris. Aber auch in Wien.
Aktuell ist die Öffentlichkeit gebannt von den vielen Flüchtlingen, die sich ihren Weg nach Europa suchen und die man meint, hier nicht versorgen zu können. Dazwischen liegen die brutalen Anschläge von Paris, wo gezielt auch Juden ins Visier von Terroristen gerieten, die sich den Anschein gaben, im Namen des Islam zu handeln.
Man fühlte sich auch in Wien nicht so ganz wohl in seiner Haut. IKG-Präsident Oskar Deutsch beruhigte, man tue alles für die Sicherheit der Gemeindeinstitutionen. Jeder könne angstfrei die Synagoge aufsuchen oder seine Kinder in die jüdischen Schulen schicken.
Wiener Maccabi-Fußballteam: Spieler wurden während eines Matches antisemitisch beschimpft.
(Foto: Robert Husa)
Gleichzeitig wird die IKG-Gemeindeführung (zu Recht) nicht müde, vor dem islamistischen Terror zu warnen. Hassprediger in einzelnen Moscheen seien ein Problem, wird immer wieder aufgezeigt. Und immer mehr Gemeindemitglieder spüren ihn auch, den Antisemitismus von islamischer Seite. Jüdische Jugendliche etwa, die beim Fußballspiel von Spielern der gegnerischen Mannschaft als „Saujude“ beschimpft werden. Inhaber kleiner Geschäfte, vor allem außerhalb des zweiten Bezirks, deren Schaufenster eingeschlagen und die von vorrangig türkischen Jugendlichen antisemitisch angepöbelt werden.
Doch trotz allem: Die Wiener Gemeinde wirbt um jüdische Zuwanderung. Chanan Babacsayv, der im Frühjahr zum neuen Vizepräsidenten der Kultusgemeinde gewählt wurde, hat für sich das Wachsen der Wiener Gemeinde als seine wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre definiert.
„Bei einer Schülerdiskussion an der Zwi-Perez-Chajes Schule gaben vergangenes Frühjahr drei von vier Jugendlichen an, vorerst in Wien bleiben zu wollen, obwohl alle mit Antisemitismus konfrontiert waren.“
Was für eine Gemengelage: Die Bedrohung für Juden nimmt in Europa zu. Gleichzeitig versichert die Gemeindeführung in Wien, man tue alles für die Sicherheit der Mitglieder, der Einzelne solle achtsam sein, sich aber nicht fürchten. Und parallel wird um Zuwanderung geworben und dabei die Lebensqualität der Stadt gepriesen.
Die Meldungen, die beim Forum gegen Antisemitismus eingehen, sprechen eine deutliche Sprache: 2013 wurden hier 137 Vorfälle protokolliert, darunter 21 Beschimpfungen, 54 Sachbeschädigungen und Beschmierungen, sieben tätliche Übergriffe. Ein Jahr später, 2014, gingen fast doppelt so viele Meldungen ein, 255 insgesamt, davon neun tätliche Übergriffe. Wenn man sich die einzelnen Kategorien allerdings näher ansieht, fällt auf: 83 der hier angeführten Fälle sind Übergriffe im Internet. 2013 war dieser Bereich allerdings noch gar nicht angeführt, was diese Statistik wieder relativiert. Einerseits.
Andererseits nehmen gerade in den sozialen Netzwerken und Foren großer Medien antisemitische Postings überhand. Oder aber es werden Bilder, die mit der Vernichtung von Juden im NS-Terrorregime verbunden sind, in der aktuellen Flüchtlingsdebatte verwendet. Dann etwa, wenn vorgeschlagen wird, die Asylwerber ins Gas zu schicken oder in einen Zug zu setzen und nach x oder y zu senden. Das wiederum schafft eine Stimmung, die den einen oder anderen dann auch im realen Alltag schon einmal antisemitisch ausfällig werden lassen.
Zum Beispiel eben auf dem Fußballplatz. Jugendliche, die für Maccabi Wien spielen, berichten immer wieder von Beschimpfungen durch Spieler der gegnerischen Mannschaft. Meist sind es dann türkische Vereine, gegen die man antritt. Und Josef Sarikov, er ist der Vorgänger Babacsayvs als IKG-Vizepräsident, der mit seiner Familie im fünften Bezirk mehrere Handygeschäfte betreibt, weiß von seinem türkischstämmigen Mitarbeiter, dass im türkischen Fernsehen gegen Juden gehetzt wird. Das macht sich dann auch im Alltag jener Juden bemerkbar, die als solche erkennbar sind. Oder von denen man in dem Viertel, in dem sie eben ein Geschäft führen, weiß, dass sie Juden sind.
Bei einer Schülerdiskussion an der Zwi-Perez-Chajes-Schule gaben vergangenes Frühjahr drei von vier Jugendlichen an, vorerst in Wien bleiben zu wollen – auch wenn schon alle mit Antisemitismus konfrontiert waren. Als besonders herausfordernd beschreiben sie die eigene Positionierung in den sozialen Netzwerken. Soll man jeden Facebook-Freund, der sich Israel-kritisch äußert, gleich entfernen? Soll man die Diskussion suchen oder sich zurückhalten? Alle haben hier die Erfahrung gemacht, dass solche Auseinandersetzungen rasch ausarten. Und dennoch: Nur eine der vier Jugendlichen gab an, Österreich nach der Matura verlassen zu wollen. Und hier vermischt sich der Wunsch, im Ausland zu studieren, mit dem Gefühl, sich in Wien eben nicht mehr ganz sicher zu fühlen.
Israel-Boykottaufruf in Bethlehem: Internationales Phänomen.
(Foto: Jim Hollander/EPA/picturededk.com)
Insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wien aktuell ein bisschen eine Insel der Seligen darstellt. Ja, die Hassposter im Netz reißen ihre Mäuler weit auf. Ja, es gibt Pöbeleien, Schmierereien. All das ist inakzeptabel und muss vom Rechtsstaat geahndet werden. Und dennoch: Eine Emigrationswelle wie jene aus Frankreich ist nicht festzustellen. Die Gemeindeführung rät nicht, wie in Teilen Deutschlands, auf der Straße keine Kippa zu tragen. Die jüdischen Einrichtungen werden von der Sicherheitsmannschaft der IKG in Kooperation mit der staatlichen Exekutive sichtbar bewacht. Ob das für alle Zeiten die Lösung sein wird, ist eine andere Frage. Wie sehr ist eine Gruppe Teil einer Gesellschaft, auf die immer – und zuletzt aufgrund der Bedrohungslage in Europa eben immer intensiver – aufgepasst werden muss?
In Teilen Deutschlands wurde vom Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit abgeraten.
(Foto: Shutterstock/Luis Carlos Torres)
Gehen oder bleiben: Die Frage wird, wenn der antisemitische Terror wieder näher rückt, gebetsmühlenartig und intensiv diskutiert. Die gepackten Koffer werden dabei immer seltener bemüht. Man scheint, die Wiener Gemeinde hat diese doch schon hinter sich gelassen. Gehen oder bleiben: In dieser Frage drückt sich die Sorge, die Angst, die Unsicherheit aus. Kaum einer beschließt aber wirklich zu gehen. Anders sieht es aus, wenn man Eltern fragt, ob sie für ihre Kinder eine Zukunft in Wien sehen. Nicht alle sind sich sicher, ob die Kinder dereinst hier bleiben werden. Hier spielen aber viele Faktoren mit hinein: Die strenge Orthodoxie schickt vor allem die Buben auf die Jeschiwe ins Ausland. Wer einen jüdischen Partner sucht, heiratet auch schon einmal nach England, nach Israel, in die USA. Und gerade in den Staaten wird gerne studiert.
„Es bleibt am Ende das Gefühl: Wirkliche Normalität, ein absolut angstfreies Miteinander, wird es auch in Wien vermutlich über Generationen hinweg nicht geben.“
Doch gerade in den Vereinigten Staaten ist das Studieren als Jude oder Jüdin zuletzt auch kein Zuckerschlecken. Die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions) hat hier vor allem in Nordamerika viel an Terrain gewonnen und antisemitische Übergriffe nehmen überhand. Die Universität Wien war zwar, wie der Wissenschaftshistoriker Klaus Taschwer eben in einer neuen Publikation belegte, vor allem in der Zwischenkriegszeit eine „Hochburg des Antisemitismus“ – heute kann man an der Alma Mater allerdings als Jüdin und Jude unbehelligt sein Studium absolvieren, wie auch an allen anderen Hoch- und Fachhochschulen des Landes.
Und so verbleibt man am Ende mit dem Gefühl: Wirkliche Normalität, ein absolut angstfreies Miteinander wird es auch in Wien vermutlich noch über Generationen hinweg nicht geben. Es gibt Phasen, in denen das subjektive Sicherheitsgefühl besser, andere, in denen es schlechter ist. Es gibt eine Bedrohungslage, die aktuell eher von muslimischer Seite kommt, die man ernst nehmen muss. Und gegen die die Exekutive entschieden vorzugehen hat, um Übergriffe und Anschläge von vornherein abzuwenden. Aber so alles in allem lebt es sich doch ganz gut in Wien. Auch das muss einmal gesagt werden.
- Alexia Weiss (Foto: Stanislav Jenis)