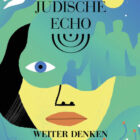Verschüttet, verschattet von Joana Radzyner
Die Innensicht der Außensicht der Innensicht: Wie man aufwächst, wenn einem andere ein Anderssein unterstellen.
„Ihr seid immer so sensibel.“ Neue Freunde, Wiener Uni, nach zwölf Jahren im sicheren Ghetto des privaten Lycée Français. Meine Mutter hatte doch recht gehabt. Man war nicht mehr wie die anderen, wenn man sich als jüdisch geoutet hatte im Wien der 1970er-Jahre. Anfangs kämpfte ich. „Warum ihr? Wo sind denn die anderen Mit-Gemeinten?“ Peinlich betretenes Schweigen. Mit der Zeit verzichtete ich auf den zermürbend-sinnlosen Versuch zu beweisen, dass ich wie die anderen war, und kapselte mich ab. Bis ein junger Armenier mit ägyptischem Pass die Mauer durchbrach.
Arnak trug wie ich Angst im Hinterkopf und schaute aus wissend-traurigen Augen. Was uns beide vereinte, führte zu Streit mit den Eltern. Er sei ägyptischer Staatsbürger, und Ägypten sei mit Israel im Krieg, sagte mein Vater. Du solltest dich in armenischen Kreisen umschauen, sagte seine Mutter.
Ich wurde in einen Kibbuz verschickt, um einen netten jüdischen Jungen kennenzulernen. Das Vorhaben scheiterte. Statt junger Israeli lernte ich junge Briten, Franzosen und Amerikaner kennen, die sich wie ich „nur unter anderem“ auch als Juden fühlten.
 Historische Ansicht von Łódź (um 1900): Herkunft aus dem polnischen Vorkriegs-Manchester.
Historische Ansicht von Łódź (um 1900): Herkunft aus dem polnischen Vorkriegs-Manchester.
(Foto: AKG-Images/picturedesk.com)
Ich hätte es früher begreifen müssen, das Stöhnen und die Schreie meiner Mutter, die uns nachts weckten und von denen sie tagsüber nichts mehr wissen wollte. Ihr Verbot, das Gasthaus am Eck zu betreten. Den Namen Kaiser, den sie beim Schuster angab oder in der Putzerei. Die jahrelangen Ermahnungen, nichts vom eigentümlichen Feiertag zu erzählen, den auch mein Großvater und mein Onkel aus Deutschland bei uns verbrachten und an dem anderes Geschirr auf den Tisch kam.
Erst viele Jahre später las mir Mama aus ihren Gedichten vor. Folgende, noch auf Polnisch handgeschriebene Zeilen fand ich erst vor kurzem in einem Stoß alter Papiere. „Gelbe Angst“:
„Der einst mir aufgedrückte gelbe Stern
Lässt gelbe Angst durch die Adern fließen
Zitternd, durchschossen, habe ich
Jahrtausendalte Angst in den Augen …“
In der Schule durften meine Schwester und ich während der Religionsstunden im Hof spielen. Wir waren „ohne Bekenntnis“. Die Eltern hatten es gut gemeint. Wir sollten, wie Mama später erklärte, keinen „jüdischen Buckel bekommen“. Wir sollten die „jahrtausendealte Angst“ nicht mehr weitertragen.
Als ich nach dem Tod beider Eltern aber erstmals in den Tempel ging, um ihnen zu Jom Kippur nahe zu sein, war ich allen anderen hier fremd. Ich war mit einem christlichen Armenier verheiratetet und kannte keine Gebete.
In der Kathedrale von Etschmiadsin, dem Sitz des Katholikos aller Armenier: Kerzen angezündet.
(Foto: Sergei Grits/AP/picturedesk.com)
Mein Großvater hatte von meiner Eheschließung erst erfahren, als ich schon hochschwanger war. Seinen Sohn plagte das Gewissen. Er hätte nach seiner zweijährigen Quarantäne mit Berufsverbot als „Geheimnisträger“ des kommunistischen Polen 1959 mit uns nach Israel auswandern sollen statt nach Österreich. Dort wäre so etwas niemals passiert. Den Tag, an dem unsere Tochter Alice geboren wurde, sah der bekennende Atheist deshalb als Zeichen göttlicher Vergebung. Dass er dabei etwas mithalf, verschwieg er später gerne. Er hatte mich am Tag der geplanten Geburt zur Seite genommen und gefragt, ob ich den Geburtstermin nicht hinauszögern könnte. Nach Mitternacht würde das Baby schon zu Rosch Haschana auf die Welt kommen.
Wir hatten Glück, und mein Vater durfte der weltweit verstreuten Verwandtschaft Telegramme mit der Nachricht von der Geburt eines jüdischen Neujahrsbabys schicken.
„Shit oder Dynamit“, witzelten wir, „eine dritte Möglichkeit kann es bei dieser Mischung nicht geben.“ Das Kind eines in Kairo aufgewachsenen christlichen Armeniers mit österreichischem Pass und einer in Warschau geborenen jüdischen Mutter wurde in Abänderung der „Jewish-American Princess“ zu unserer „Jewish-Armenian Princess“ gekürt.
Der Humus, auf dem diese Mischung im Wien der 1980er-Jahre gedeihen konnte, war das Lycée Français de Vienne. Hier durften Kinder mit unterschiedlichsten ethnischen und religiösen Backgrounds eine Jugend ohne Diskriminierung leben.
Meine Eltern, Kinder aus begüterten, orthodoxen Kaufmannsfamilien im polnischen Vorkriegs-Manchester Łódź, waren Überlebende des Ghettos Łódź und der Konzentrationslager Auschwitz und Stutthof. Im gleichmachenden Kommunismus würde es keine „Jüdische Frage“ mehr geben, hatten sie als Mitglieder einer marxistisch-leninistischen Widerstandsbewegung während des Krieges geglaubt. Sie wurden enttäuscht. Die Namensänderung, zu der die Partei meinem blauäugigen und blonden Vater geraten hatte, konnte den mit 21 Jahren jüngsten Abgeordneten des polnischen Parlaments der ersten Nachkriegsjahre nur für kurze Zeit vor antisemitischen Angriffen schützen. Die Partei degradierte den unbeirrbaren Idealisten schon Ende der 1940er-Jahre zum Schulinspektor und Redakteur einer gleichgeschalteten Zeitung für die Landbevölkerung.
Für die Juden, die nach dem Krieg in die alte Heimat zurückgekehrt waren, wurde das Klima immer rauer. Das blutige Pogrom von Kielce 1946 war nur der Vorbote des virulenten Antisemitismus, der 1968 seine hässlichste Fratze zeigte. Damals lebten meine Eltern schon in Wien, aber unsere Mietwohnung in der Porzellangasse 27 wurde zur Anlaufstelle für die vielen Freunde aus Polen, die als Juden mit Berufsverbot belegt und zur Auswanderung gezwungen wurden. Meine kleine Schwester und ich mussten unser Kinderzimmer räumen, um den Gästen wider Willen so lange Platz zu machen, bis sie nach langen Monaten der Unsicherheit und mittellos nach Israel auswandern durften. Meine Mutter hatte diese Erfahrungen schon früher gemacht. Sie thematisierte dieses Trauma im Gedicht „Porzellangasse“, das unter ihrem Namen Tamar Radzyner 1992 im Verlag Der Apfel im Sammelband „Jüdische Lyrik aus Österreich“ erschien.
„In meiner alten Heimat
die mir keine Heimat
sein wollte
baute man
bunte Häuser
auf den Gettoruinen.
Nachts
glühten die Fundamente,
der Rauch stieg in die Augen,
es tönten die Osterglocken.
Mit zerplatzten Lippen
schrien wir Totengebete.
Das hat die Nachbarn gestört,
in bunten neuen Häusern,
das hat die Ruhe gestört,
man hieß uns weitergehen.“
Renommierte israelische Privatuniversität „Interdisciplinary Center Herzliyah“ (IDC): Ein Onkel als Mitbegründer.
(Foto: IDC Herzliya-International School)
In Wien wollten meine Eltern ihre politische Vergangenheit und ihre jüdischen Traditionen vergessen. Mit einem Medizinstudium hofften sie eine neue Zukunft zu finden. In „Gelbe Angst“ schreibt meine Mutter:
„Ich habe meinen Namen vergessen
Den Schein der Kerzen am Schabbat-Tisch
Will durch keine Erinnerung mehr anders sein.
Mein Gedächtnis heißt Einsamkeit.“
Mein Vater wurde erst nach dem Tod meines Großvaters Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde. Das Schiwa-Sitzen mit seinem jüngeren Bruder Harry in Düsseldorf hat längst verschüttet Geglaubtes wieder hochschwappen lassen. Onkel Harry erzählt, sein Bruder habe alle Gebete aus dem Gedächtnis gesprochen und sich in der Trauerzeit an alle religiösen Vorschriften gehalten. Nach seiner Rückkehr nach Wien ging mein Vater zum ersten Mal seit unserer Ankunft in Österreich in den Tempel. Oberrabbiner Chaim Eisenberg soll nach dem Gottesdienst neugierig auf ihn zugegangen sein und gefragt haben, ob er Deutsch verstehe und woher er komme.
Kurz vor seinem eigenen Tod besuchte mein Vater für einige Tage die alte Heimat. Er wollte die Gräber seiner noch vor dem Krieg verstorbenen Großeltern sehen. Meine Mutter verweigerte die Mitreise. Sie wollte nie mehr zurück in das Land, das seine wenigen Juden in die Emigration gezwungen hatte.
Arnak wurde als 13-Jähriger mit einer Maschine aus Kairo nach Wien verschickt. Unbegleitet. Die zwei älteren seiner vier Schwestern hatten diesen Weg schon vor ihm zurückgelegt. Aspé und Mané wohnten in einem von Klosterschwestern geführten Mädchenpensionat im 19. Bezirk, zur Schule gingen sie ins Lycée. Auch Arnak. Die Eltern blieben noch lange in Kairo. Der Vater, Dr. Zareh Madghashian, hatte ein florierendes pharmazeutisches Unternehmen gegründet, das nach der 1952 erfolgten Machtergreifung Nassers verstaatlicht wurde. Als die neuen Machthaber auch die Schulen unter ihre Kuratel stellten, beschloss er, die Kinder nach Europa zu schicken. Es waren enge Freunde Zarehs aus seiner Studienzeit in Lausanne, die für ihren Unterhalt in Wien aufkamen. Ägyptischen Staatsbürgern war die Geldausfuhr verboten.
„Ihre polnischen Pierogi schmecken genau so gut wie ihre israelisch-libanesischen Falafel oder die armenische Pizza. Zu den drei „Muttersprachen“ sind weitere dazugekommen.“
Zareh war abgehärtet. Er hatte sich als Kind allein aus der Türkei nach Ägypten durchgeschlagen. Vom Todesmarsch durch die Wüste 1915 war ihm eine dicke Narbe von einem türkischen Peitschenschlag am Rücken geblieben. Die Eltern kamen um.
Arnaks Mutter war untröstlich über die Trennung von den Kindern. Sie entstammte der alteingesessenen armenischen Familie Jakubian und hatte vor ihrer Heirat ein Medizinstudium in Kairo begonnen. Als wir heirateten, lebten Arnaks Eltern nicht mehr.
Alice wuchs mehrsprachig auf. Mit mir sprach sie deutsch, mit ihrem Vater armenisch, mit der Kinderfrau und meinen Eltern polnisch. Wie uns der Kinderarzt vorausgesagt hatte, brachte sie auf diese Weise die drei Sprachen niemals durcheinander.
Wenn sie abends zu Bett gebracht wurde, sagte sie mit der Kinderfrau das polnische Vaterunser auf, wonach Arnak an ihr Bettchen ging und armenisch mit ihr betete. Wenn dann ich zum Gutenachtkuss kam, leuchteten ihre Augen. „Mama nein Amen“, rief sie aus und klatschte in die Hände.
Wir beschlossen, auch sie ins Lycée zu schicken. Nach langen Diskussionen stand auch fest, dass Alice in den jüdischen Religionsunterricht gehen würde. Für Arnak als armenisch-orthodoxen Christen war nur wichtig, dass sie nicht ohne Gott aufwächst. Ich wiederum wollte nicht, dass auch sie „ohne Bekenntnis“ bleibt und wie ich auch unter den „Insrigen“ eine Fremde bleibt.
Aus den Lycée-Jahren in Wien und Prag sind Alice wichtige Freunde geblieben. Die muslimische, syrisch-slowakische Izabelle gehört genauso dazu wie der bucharisch-jüdische Arik oder Georges, dessen Eltern als Christen in den 1970er-Jahren aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Libanon auswandern mussten.
In ihren Bewerbungsschreiben für diverse Hochschulen stellte sich Alice als „mixed salad“ vor. Pessach, Rosch Haschana und Jom Kippur gehören genauso zu ihrem Leben wie das armenische Weihnachtsfest am 5. Jänner. Ihre polnischen Pierogi schmecken genauso gut wie ihre israelisch-libanesische Falafel oder die armenische Pizza Lachmadschun. Und zu ihren drei „Muttersprachen“ sind inzwischen noch Französisch, Englisch, Spanisch, Tschechisch und rudimentäres Arabisch dazugekommen.
Zu Arnaks Sechziger flogen wir nach Armenien, in die Heimat seines Vaters, von der er nur wusste, dass nirgendwo anders Wassermelonen so süß und Schafkäse so würzig waren. In der Kathedrale von Etschmiadsin, dem Sitz des geistigen Oberhaupts der Armenischen Apostolischen Kirche, zündete auch Alice eine Kerze an. Ihr Vater weinte.
Onkel Harry, der die Gräuel der Konzentrationslager als Volksschüler erlebte, wählte einen anderen Weg als meine Eltern und ich. Schon bald nach dem Krieg wurde er von meinem damals schon verwitweten Großvater zu dessen Schwester in die USA geschickt. In New York lernte Harry, als Jude wieder „aufrecht zu stehen“, wie er sagt. Er lebt inzwischen in Düsseldorf und in Palma de Mallorca und unterstützt da wie dort die jüdische Gemeinde. Hätte er Kinder gehabt, wäre er als traditionsbewusster Jude nach Israel gegangen. Nur dort gebe es eine angstfreie Zukunft – allen Bomben aus der feindlichen Nachbarschaft zum Trotz.
Am Jom haSchoah 2006 legte Onkel Harry als Mitbegründer und Mitfinanzier des privaten universitären „Interdisciplinary Center Herzliyah“ (IDC) in einer berührenden Rede den Studenten ans Herz, niemals in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Es habe in den Jahren des Naziterrors auch gute Deutsche gegeben – und unanständige Juden, unterstrich er.
Auch in Österreich, wo die Gräber meiner Urgroßmutter, meines Großonkels, meiner Eltern, meiner Schwester und meiner kleinen Nichte sind, kenne ich inzwischen nicht-jüdische Menschen, die mein Jüdischsein verstehen. Sie bestärken meine Hoffnung, dass „wir“ hier trotz wachsender Israel-Kritik und antisemitischer Ausfälle zu Hause sind.
- Joana Radzyner (Foto: privat)