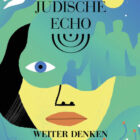Mehr als Erinnerung von Joana Radzyner
 Das neue Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau
Das neue Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau
Die Eröffnung der „Dauerausstellung“, die dem Museum der Geschichte der polnischen Juden im schmucklosen Warschauer Plattenbauviertel Muranow ihren unverwechselbaren Stempel aufdrücken soll, war für Ende Oktober angesagt. Doch der neue Würfel aus Glas, Kupfer und Stahl zog schon in den vorangegangenen Monaten tausende Besucher auf den Platz, den bisher das Denkmal der Helden des Warschauer Ghetto-Aufstandes 1943 prägte.
Verstörend die riesige, einen Riss durch die gläserne Fassade ziehende Spalte – für manche die Versinnbildlichung des biblischen Weges der Juden durch das Rote Meer, für andere Symbol der Shoah als des dramatischen Einschnitts in der Geschichte der Juden auf polnischem Staatsgebiet.
Geheimnisvoll die von weitem sichtbaren Zeichen auf den Glaspaneelen, ineinander verwobene polnische und hebräische Buchstaben, die das Wort „polin“ ergeben – im Hebräischen „Polen“, aber in einer zweiten Bedeutung auch „hier kannst du ruhen“, das Motto der Juden, die sich aufgrund ihrer weltweiten Verfolgung im 16. Jahrhundert im toleranten Polen niederließen.
„Von einem solchen ,Bilbao-Effekt‘ habe ich immer geträumt“, freut sich der Vorsitzende des Rates des neuen Museums, Marian Turski, der als Vorstand des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau auch zu den Vorkämpfern und Mitbegründern des Museums zählt. Wie das Guggenheim-Museum in Bilbao seinen Ruhm vor allem dem Stararchitekten Frank Gehry verdanke, so habe dem neuen Warschauer Museum das international bis vor kurzem noch unbekannte finnische Architektenduo Lahdelma & Mahlamäki zu weltweiter Aufmerksamkeit verholfen.
Eingang des neuen Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau: Architektur mit „Bilbao-Effekt“, Foto: Magda Starowieyska / Museum of the History of Polish Jews
Errichtet auf den Ruinen eines Kasernengebäudes aus dem 18. Jahrhundert, das in der Zeit des Ghettos der Sitz des „Judenrates“ war, will das neue Museum auch inhaltlich neue Wege gehen. Im Gegensatz zu allen bestehenden soll es ein „Museum der Lebenden“ sein, erläutert der 88-jährige Ausschwitz-Überlebende Marian Turski.

 Mitten im ehemaligen Warschauer Ghetto steht das vom finnischen Architektenduo Ilmari Lahdelma und Rainer Mahlamäki geplante Museum, das die historische Präsenz der Juden in Polen zeigen soll
Mitten im ehemaligen Warschauer Ghetto steht das vom finnischen Architektenduo Ilmari Lahdelma und Rainer Mahlamäki geplante Museum, das die historische Präsenz der Juden in Polen zeigen soll
Foto: Wojciech Krynski / Museum of the History of Polish Jews
„In erster Linie wollen wir, dass die jugendlichen Besucher, von denen die meisten nie von einer jüdischen Minderheit in Polen gehört haben, mit dem Wissen und in dem Bewusstsein hinausgehen, dass es hier tausend Jahre lang ein Volk gegeben hat, das mit den Polen oder zeitweise auch nur neben den Polen lebte und heute nicht mehr da ist. Diese historische Präsenz der Juden, die bisher nur durch die Lektüre klassischer Texte und durch Gemälde oder Fotografien von einst hier präsenten Juden fühlbar werden konnte, will unser Museum wiederaufleben lassen. Nur so wird sich sinnlich und intellektuell das Vakuum begreifbar machen lassen, das die Shoah in Polen hinterlassen hat“, sagt Turski.
Als besonders schwierig und zeitaufwendig erwies sich für die Museumsinitiatoren die konkrete Umsetzung dessen, was die einzigartige Stärke des Museums der Geschichte der Juden in Polen ausmachen sollte: Es gab und gibt sie nicht, die eine einzig richtige Auslegung historischer Ereignisse. Weshalb zusätzlich zu den mehr als hundert international führenden Historikern, die an den einzelnen Zeitabschnitten von tausend Jahren Erzählung jüdischer Präsenz auf polnischem Boden gearbeitet haben, weitere 15 ausgewiesene Historiker und Holocaustforscher der Gegenwart zur Begutachtung der Arbeit ihrer Kollegen gebeten wurden. Das Ergebnis macht Turski, den rastlos-engagierten geistigen Vater des Museumsprojekts, glücklich: „Bei seiner letzten Sitzung hat der Expertenrat die Dauerausstellung, also das künftige Herzstück des Museums, in ihrer Gewichtung und jetzigen Gestalt einstimmig angenommen.“
Auf 4000 Quadratmetern wird der Besucher auf seinem Gang durch teilweise unterirdische und multimedial aufbereitete Galerien die Geschichte der Juden von ihren Anfängen im Mittelalter über die Welt der Schtetl und die Zeit der nationalsozialistischen Todeslager im Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart nachempfinden können. Auf jeder der insgesamt acht Stationen soll dabei die ständige Verflechtung zwischen der jüdischen und der polnischen Kultur sichtbar werden.
Um die Vergangenheit auch sinnlich erlebbar zu machen, wurden neben einer von den Nazis zerstörten farbenfrohen Holzsynagoge aus dem Galizien des 17. Jahrhunderts auch ein Bahnhof, ein Kaffeehaus und sogar die Brücke nachgebaut, die das Warschauer Ghetto vom „arischen“ Teil der Stadt trennte. Am Ende des „Korridors der Shoah“ hingegen bleiben die Wände kahl – als Symbol der Leere nach dem Tod von drei Millionen polnischen Juden.
Rekonstruktion einer Holzsynagoge im südpolnischen Gwozdziec aus dem 17. Jahrhundert in der neuen Dauerausstellung des Museums
Foto: Magda Starowieyska / D. Golik / Museum of the History of Polish Jews
Das gesellschaftspolitische Umfeld im jungen EU- und Nato-Mitgliedsstaat Polen ist heute empfänglicher für das Wissen um und über das Judentum. Jenseits von kitschiger Beisl-Renaissance und Klezmer-Nostalgie geht der traditionelle, national-katholisch geprägte Antisemitismus zurück – besonders unter den Jugendlichen. Das Interesse an den verschwundenen Nachbarn oder an der Erforschung der eigenen Familiengeschichte, wo bleierne Stille lange alle Antworten ersetzte, ist offensichtlich. Und das Museum will auch diese Neugierde stillen: In einer aufwendig aufbereiteten Datenbank wird man nach allfälligen Vorfahren suchen und gegebenenfalls auch die Herkunftsorte im Land erforschen können.
Mit einer Bibliothek und der Mediathek, großzügigen Veranstaltungsräumen für Seminare und spezialisierten Diskussionsforen will sich das Museum darüber hinaus als Kultur- und Bildungszentrum etablieren und von der EU in Zukunft als „europäische Bildungsinstitution“ anerkannt werden.
Die weitgereiste, auf Restitutionsfragen für geraubte jüdische Kunst spezialisierte Kunsthistorikerin Nawojka Cieslinska-Lobkowitz setzt große Hoffnungen in dieses weltweit einzige jüdische Museum, das sich physisch an einem Ort befinde, wo Aufständische gekämpft haben und Menschen sterben mussten, das zugleich aber den Anspruch erhebe, Zeugnis des Lebens zu sein und deshalb jüdisches Leben in Polen nicht mit der Shoah enden zu lassen. Der Erfolg werde von der Unbeirrbarkeit und Unbestechlichkeit aller Entscheidungsträger abhängen: „Gelingt es dem Museum, sich neben einem reichen Angebot an wechselnden Ausstellungen auch als Forschungs-, Bildungs- und Kulturinstitution zu etablieren, wird es als würdiger Nachfolger Emanuel Ringelblums und seiner Mitarbeiter vom Ghetto-Archiv Oneg Shabat anerkannt werden und sowohl unter den Polen als auch unter den Israelis und in der jüdischen Diaspora Vertrauen genießen. Wenn es nur ein mittelmäßiges Programm anbietet, um den kurzfristigen Erwartungen der Regierenden und der Sponsoren nachzugeben, wird es scheitern.“
Die Anfänge sind vielversprechend.
Wer auf einer Sitzbank vor dem Museum Platz nimmt, kann eine Stimme vernehmen. Es handelt sich um den Bericht des polnischen Untergrundkämpfers Jan Karski, der 1942/43 eine Kurierfahrt nach London unternahm, um die Welt über die menschenunwürdigen Verhältnisse im Warschauer Ghetto und die systematische Ermordung der Juden in nazideutschen Vernichtungslagern zu informieren. Doch weder die polnische Exilregierung in London noch die Regierungen Großbritanniens und der USA schenkten ihm damals Glauben.
Joana Radzyner Foto: privat