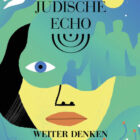Spaniens Sephardim: Heimkehr nach 550 Jahren? von Josef Manola

Spaniens Regierung lancierte ein Gesetzesprojekt, das den Nachfahren der im 15. Jahrhundert vertriebenen Sephardim ab 2015 den Zugang zur spanischen (Doppel-)Staatsbürgerschaft eröffnet. Die davon Betroffenen sind noch skeptisch.
Marcelo Benveniste ist Aktivist in Sachen sephardischer Tradition. Sein Privatleben abseits der beruflichen Verpflichtungen in Buenos Aires dreht sich ausschließlich um Erhaltung und Förderung eines Erbes, das er mit vielen Juden in der Diaspora teilt. Benveniste sitzt jeden Freitag vor dem Mikrofon von „Radio Sefarad“ und erzählt von einer Welt, in der man Ladino sprach. „Radio Sefarad“ ist ein Kommunikationsprojekt der jüdischen Gemeinden Spaniens. Benveniste organisiert über die Radioarbeit hinaus für Interessierte auch Kurse, in denen die Sprache mit den altspanischen Anklängen erlernt werden kann. Marcelo begleitet auch noch seine Frau auf Konzerttourneen durch Israel oder Europa.
Liliana Benveniste singt nämlich „Kantes judeo-españoles“ – Melodien, die sich mit den aus Spanien vertriebenen Juden im Lauf der Jahrhunderte über den gesamten Mittelmeerraum verbreiteten. Marcelo und Liliana haben sich einer Aufgabe verschrieben: die wehmütigen Lieder der Sephardim auch für die nachfolgenden Generationen zu retten. Von den geschätzten 300.000 Juden in Argentinien sind rund 20.000 bis 40.000 sephardischer Herkunft.
Früher war der Nachweis der spanischen Abstammung eine Frage der Familienhistorie, des Andenkens an einen „fremden“ Ursprung. Im Fall von Benveniste sind es vier Großeltern, die bis zur Flucht vor den Nazis in einer Sephardim-Gemeinde auf der Insel Rhodos lebten. „In allen Verzeichnissen“, erzählt der 56-jährige Vater von zwei Kindern, „wird der spanische Ursprung der Familiennamen meiner Großeltern, Benveniste und Alhadeff, bestätigt.“
Inzwischen ist für viele mit der sephardischen Abstammung auch die Aussicht auf eine EU-Staatsbürgerschaft verbunden: Die konservative Regierung Spaniens lancierte ein Gesetzesprojekt, das nach seiner Verabschiedung im Madrider Parlament ab 2015 Sephardim den Zugang zur spanischen (Doppel-)Staatsbürgerschaft eröffnen könnte.
Eine Art „Wiedergutmachung“ für die Vertriebenen, das wollte der spanische Justizminister Alberto Ruiz Gallardón den Nachkommen der sephardischen Juden mit dem Aufnahmegesetz bieten. Sie waren die Opfer der Verfolgung durch die katholischen Könige im 15. Jahrhundert und wurden vor die Alternative gestellt, entweder ihrem Glauben abzuschwören und als Konvertiten zu Spaniern zweiter Klasse zu werden oder den Weg ins Exil anzutreten.
Viele nahmen den Verlust ihres Zuhauses, ihrer Existenz in Kauf und zogen weg. Im Zuge der Auswanderungswelle siedelten sich Juden aus Spanien im gesamten Mittelmeerraum an. Venedig, Ancona, Istanbul, Kairo, Rhodos und Jerusalem wurden zu Zentren der Sephardim.
„Marcelo und Liliana Benveniste haben sich in Argentinien der Aufgabe verschrieben, die wehmütigen Lieder der Sephardim für die nachfolgenden Generationen zu retten.“
Eines ist den Nachkommen der Auswanderer gemeinsam: „Wir haben uns“, sagt Marcelo Benveniste, „ein starkes Heimatgefühl bewahrt und nie aufgehört, uns als Spanier zu fühlen.“
Eine überraschende Aussage, bedenkt man die Gräuel der Judenverfolgung zu Zeiten der katholischen Könige Fernando und Isabel und während der Inquisition. „Trotz der schrecklichen Ereignisse, die historisch belegt sind“, antwortet Benveniste auf meinen Einwand, „ist dieses Gefühl unter den Sephardim ‚unerklärlicherweise‘ weit verbreitet.“
Die sephardische Sängerin Liliana Benveniste und ihr Mann Marcelo, der Radiomacher, vor dem Maimonides-Denkmal im spanischen Córdoba
Foto: Marcelo Benveniste
Für Einreisewillige könnte das neue Gesetz, das sich im Begutachtungsverfahren befindet, ein langwieriges und kompliziertes Verfahren vereinfachen, die begehrte EU-Staatsbürgerschaft zu erlangen. Wer zurzeit mit dem Hinweis auf seine spanische Abstammung bei den Behörden vorstellig wird, muss nicht nur auf seine bisherige Staatsbürgerschaft verzichten, sondern auch einen Wohnsitz in der EU nachweisen können.
In Zukunft könnte der Zugang zum spanischen Pass wesentlich erleichtert werden – das erhoffen sich jüdische Vereinigungen und Experten, die in dem Verfahren bisher Stellung nahmen. Für Isaac Querub vom Verband der spanischen jüdischen Gemeinschaften FCJE handelt es sich zuallererst um eine „symbolische Geste“ des Staates, das an den Juden begangene Unrecht anzuerkennen. Dennoch könnte das bevorzugte Aufnahmeverfahren für Menschen, die sich auf der Flucht vor religiöser Verfolgung in anderen Ländern befinden, eine Bedeutung bekommen.
Für Wirtschaftsflüchtlinge sei Spanien kaum der geeignete Ort, neu zu beginnen, meint Marcelo Benveniste. Das Land habe die Finanzkrise noch nicht überstanden und eine Emigrationswelle von ausländischen Arbeitskräften hinter sich. Mehrere hunderttausend Menschen haben seit dem Ausbruch der Krise Spanien wieder verlassen. Bei einer Arbeitslosenrate von rund 25 Prozent seien die wirtschaftlichen Perspektiven für Zuwanderer gegenwärtig nicht eben rosig.
Auch bei Experten ist eine gewisse Zurückhaltung spürbar. Anwälte, die sich mit Einbürgerungsverfahren beschäftigen, sind noch skeptisch: „Erst wenn das Gesetz von den Cortes verabschiedet wurde und im ,Boletín Oficial del Estado‘ erschienen ist, werde ich den Text genau unter die Lupe nehmen“, meint ein in Madrid tätiger Rechtsanwalt.
Erfahrungen mit Schnellverfahren bei der Vergabe von Staatsbürgerschaften hat Spanien bereits gesammelt. Nachkommen ausgewanderter Spanier in der ersten oder zweiten Generation kamen in den Genuss eines beschleunigten Einbürgerungsverfahrens. Die Bescheinigung mit originalen Dokumenten fällt allerdings auch leichter als der Nachweis sephardischer Ahnen aus der Zeit vor 500 Jahren.
Typische Namen wie Amselem, Benhamu, Beguigui oder Benarroch, die in den Verzeichnissen sephardischer Familien zu finden sind, decken nicht alle Familien spanischer Herkunft ab. Auch der über Generationen weitergegebene Sprachgebrauch des Ladino oder der im Westen des Mittelmeeres verbreiteten Haketia ist im vergangenen Jahrhundert stark zurückgegangen. Eine „Sprachprüfung“ in Ladino würde viele berechtigte Anwärter nicht einbeziehen, meint Marcelo Benveniste.
„Für Nachkommen ausgewanderter Spanier gibt es ein beschleunigtes Einbürgerungsverfahren. Ihnen fällt die Vorlage von Originaldokumenten allerdings leichter als der Nachweis sephardischer Ahnen.“
So müssen sich die tausenden Interessierten, die sich in den Konsulaten von Jerusalem oder Buenos Aires auf die Zeitungsmeldungen vom außerordentlichen Aufnahmeverfahren bereits gemeldet haben, vorerst noch gedulden. Marcelo Benveniste befürchtet inzwischen, dass die bevorzugte Behandlung einer kleinen Gruppe auch Feindseligkeiten auslösen könnte. Er sieht eine Gefahr des Aufflammens antisemitischer Ressentiments und verweist auf das letzte Basketballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und dem FC Barcelona, in dessen Folge es zu Angriffen auf Twitter kam.
Ein weiteres Beispiel unreflektierter Aggression liefert ein Senator der kommunistischen Vereinten Linken (IU) aus der Region Asturien. Jesús Iglesias richtete in seinem persönlichen Twitter-Konto an Justizminister Gallardón die Frage: „Wie vielen Kriegsverbrechern werden Sie als Nachkommen von Sephardim die spanische Staatsbürgerschaft verleihen?“
Benveniste freut sich dennoch über das Angebot der spanischen Regierung, die EU-Staatsbürgerschaft an Juden mit spanischen Vorfahren zu vergeben. „Ich sehe es als Anerkennung unserer Abstammung.“ Die Geste hätte für ihn ausschließlich symbolischen Charakter, betont er. Benveniste geht es – trotz der schweren Finanzkrise, in der sich seine Heimat Argentinien einmal mehr befindet – nicht um eine Auswanderung ins Land, das seine Ahnen vor über 500 Jahren verlassen mussten. Dennoch würde er sich um den spanischen Reisepass anstellen, „weil ich Spanien liebe“.
radiosefarad.com
http://lilianabenveniste.com.ar
http://fcje.org
Josef Manola Foto: Thomas Ramstorfer / ORF