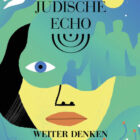Ihrer Zeit voraus
Von Alexia Weiss

Therese Schlesinger war unter den ersten acht Frauen, die 1919 ein Mandat im Parlament erringen konnten. Davor hatte sie sich lang für das Frauenwahlrecht und für Bildung für Frauen und Mädchen eingesetzt. Über eine Frau, die wohlsituiert in einer liberalen jüdischen Familie aufwuchs und sich später an die Seite von Arbeiterinnen stellte. Eine, deren Leben von Schicksalsschlägen geprägt war, die sich in ihrem Kampfgeist aber nicht beirren ließ.
„Da gibt es immer noch sehr viele Männer und Frauen, die meinen, das ist ja etwas Naturgegebenes, dass die Frau alle Hausarbeiten zu verrichten hat. Aber es ist gar nicht naturgegeben, davon können Sie sich sehr leicht überzeugen. Alle die Arbeiten, die man für die natürlichen Aufgaben der Frau ansieht, die können zu Aufgaben für den Mann werden, sobald sie bezahlt werden. Es gibt männliche Köche, es gibt männliche Stiefelputzer, Fensterputzer, Wohnungsaufräumer, Friseure und so weiter. Jede dieser Arbeiten, von denen man sagt, sie seien der Frau natürlich, die machen Männer sehr gut, wenn sie dafür bezahlt werden. Sie machen sie allerdings nicht ohne Bezahlung.“
Ersetzt man die hier von Therese Schlesinger genannten Berufe durch Pflegekraft, Kindergartenpädagoge oder Reinigungskraft, sprach sie vor hundert Jahren an, was teilweise noch heute gilt. Versorgungsarbeiten werden auch dieser Tage von vielen Frauen – neben der Erwerbsarbeit – ohne Entgelt erledigt, während Männer daraus einen Beruf machen. Mit ihren Befunden war die Sozialdemokratin ihrer Zeit teils weit voraus: Manches durfte sie jedoch noch selbst erleben. Viele Jahre etwa hatte sie für das Frauenwahlrecht, das aktive und passive, gekämpft. 1919 durfte sie dann gemeinsam mit sieben weiteren weiblichen Abgeordneten in das Parlament einziehen (siehe Kasten).
Einiges an ihrer Motivation, sich politisch zu engagieren, schöpfte sie aus der Frustration über Hemmschwellen, denen sie selbst ausgesetzt war. Während ihre Brüder eine höhere Bildung absolvieren konnten, war für sie nach der Bürgerschule Schluss. Ein Leben lang sollte sie sich daher für Bildung für Frauen einsetzen. Darüber hinaus erkannte sie, dass Arbeiter und Arbeiterinnen sich nur mittels Bildung emanzipieren und für ihre Rechte kämpfen konnten.
Einen Teil ihrer Motivation schöpfte sie aber auch aus ihrem Aufwachsen in einer liberalen jüdischen Familie, wie Birgit Jaindl in ihrer Diplomarbeit (Universität Wien) über Schlesinger nachzeichnet. Der Vater, Albert Eckstein, ein Chemiker und Erfinder, betrieb die erste Pergamentfabrik in Europa. Die im Allgemeinen vorherrschende schlechte Arbeitssituation der eingewanderten Arbeiter versuchte er in seinem Betrieb besser zu gestalten. Dabei setzte er auf Arbeitszeitverkürzung und eine Krankenversicherung für die Beschäftigten.

In einer liberalen jüdischen Familie als Tochter eines Unternehmers aufgewachsen, entwickelte Therese Schlesinger große Anteilnahme für die Arbeiter
© VGA
Doch Schlesinger war nicht nur durch die sozialdemokratische Einstellung des Vaters geprägt. Die 1863 in Wien Geborene und ihre Geschwister wuchsen gemeinsam mit den Kindern der Arbeiter auf – im Betrieb wurde ein gutes Verhältnis der Betreiberfamilie mit den Beschäftigten gepflegt. „Diese Vertrautheit förderte bei den Kindern Amalie und Albert Ecksteins eine große Anteilnahme an dem Los der Arbeiter und ein tiefgreifendes Verständnis für deren Situation. Der Wunsch nach Mitarbeit zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen wurde besonders bei Therese zur Lebensaufgabe“, hält Jaindl fest.
Therese Eckstein heiratete 1888 den Bankangestellten Victor Schlesinger. 1890 kam Tochter Anna zur Welt. Die nächsten zweieinhalb Jahre kämpfte die Mutter jedoch gegen eine schwere Erkrankung: Sie hatte sich mit Kindbettfieber und Rotlauf infiziert und konnte sich nur im Rollstuhl oder auf Krücken fortbewegen. Ihr Mann steckte sich wiederum mit Tuberkulose an – und überlebte nicht. So zog sie Anna, die ebenfalls sehr kränklich war (sie hatte eine schwache Lunge), alleine groß. Die Tochter nahm sich allerdings im Erwachsenenleben 1920 das Leben.
All diese Tragödien trugen aber auch dazu bei, dass sie sich politisch zu engagieren begann. Biografin Jaindl konstatierte, dass Schlesinger erst bei ihrem langen Krankenhausaufenthalt nach der Geburt ihrer Tochter von einer organisierten Arbeiterpartei erfuhr. In der Folge interessierte sie sich für die Arbeiterbewegung. Hier war weniger ihr politisches Bewusstsein ausschlaggebend, sondern mehr ihr persönliches Bedauern, nicht an einer Universität studiert haben zu können. Wie sie sich in der Arbeiterbewegung engagieren sollte, wusste sie anfangs nicht so recht. Sie spürte das, was man ihr später auch als Nationalratsabgeordnete vorhalten sollte – ihre bürgerliche Herkunft schien ihr im Weg zu stehen.

Therese Schlesinger (mit verschränkten Armen) und weitere weibliche Abgeordnete 1919 im österreichischen Parlament
© VGA
Über ihre Freundin Marie Lang stieß sie jedoch schließlich zum Allgemeinen Österreichischen Frauenverein. Dort erfuhr sie von der Lebensrealität der Arbeiter und Arbeiterinnen und näherte sich politisch dem Sozialismus. Sie wollte Seite an Seite mit einfachen Frauen für deren Rechte kämpfen. Sie verließ daher den bürgerlichen Frauenverein und trat 1897 in die sozialdemokratische Partei ein. 1898 nahm sie aktiv am Buchbinderstreik teil. Sie hielt Kurse, publizierte in der „Arbeiterzeitung“, vertiefte sich in gewerkschaftliche Arbeit. Als Ziele formulierte sie die Verbesserung der Lebenssituation der Arbeiterschaft und die Mädchen- und Frauenbildung. „Sie erkannte, dass nur ausreichende Bildung und durch die damit verbundene Aufklärung das Proletariat aus der Knechtschaft führen konnte. Für diese politische Bewusstseinsbildung trat Schlesinger in ihren Schriften und Feuilletons immer wieder ein“, so Jaindl.
Gegen Frauenkämpferinnen
Schon 1900 brachte sie beim Parteitag der sozialdemokratischen Partei in Graz einen Antrag zur Einführung des Frauenwahlrechts ein. Er wurde abgelehnt, denn auch innerhalb der Sozialdemokratie gab es Widerstände gegen Frauenkämpferinnen wie Schlesinger. Ein Jahr später begründete sie den Verein sozialdemokratischer Frauen und Mädchen mit – 1906 wurde schließlich der Antrag für ein Frauenwahlrecht angenommen. Während des Ersten Weltkriegs trat sie gemeinsam mit Viktor Adler und Otto Bauer für Frieden ein. Schon als Parlamentarierin verfasste sie die frauenpolitischen Teile des Linzer Parteiprogramms von 1926. Dem Nationalrat gehörte sie bis 1923 an, im Anschluss saß sie bis 1930 im Bundesrat. 1933 zog sie sich, inzwischen siebzigjährig, ins Privatleben zurück. 1939 musste sie nach Frankreich emigrieren, wo sie 1940 verstarb.
In der Wiener Josefstadt erinnert heute der Schlesingerplatz an die kämpferische Sozialdemokratin. Lange nach dem christlich-sozialen Politiker Josef Schlesinger (1831–1901) benannt, der als Anhänger Karl Luegers auch für seinen eigenen Antisemitismus bekannt war, wurde der Platz im Februar 2006 unter einer damals grünen Bezirksvorstehung Therese Schlesinger gewidmet und erinnert so an ihren Einsatz für die Besserstellung von Mädchen und Frauen.
Zu ihren wichtigsten Forderungen zählten laut Parlamentshomepage gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche politische Rechte für Frauen und Männer, eine Arbeitszeitverkürzung für Mütter, eine staatliche Mutterschaftsversicherung, eine allgemeine Kinderversicherung und die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruches. Sie setzte sich gegen die Prügelstrafe und für eine ambulante Betreuung psychisch Kranker ein. Von ihr stammte auch die Idee, in den Wohnhäusern der Arbeiter Zentralküchen und Wäschereien einzurichten. So hätten Frauen mehr Zeit für familiäre Beziehungen und Fortbildung, war ihre Hoffnung.
Leicht hatte sie es bis zuletzt auch in der eigenen Partei nicht. So heißt es in dem von Saskia Stachowitsch und Eva Kreisky herausgegebenen Band „Jüdische Identitäten und antisemitische Politiken im österreichischen Parlament 1861–1933“ über Schlesinger: „In Therese Schlesinger vereinten sich verschiedene Merkmale, die eine Angriffsfläche boten – jedoch nicht nur für politische GegnerInnen, sondern auch für Missgunst aus den eigenen Reihen. Als Frau, die für Gleichberechtigung kämpfte, hatte sie mit dem Widerstand von Genossen, auch in der Gewerkschaft, zu kämpfen und als bürgerliche Frau begegneten ihr sozialdemokratische Genossinnen zunächst mit Skepsis. Dass Schlesinger Jüdin war, nutzten auch sozialdemokratische Proponenten wie der deutschnational gesinnte Engelbert Pernerstorfer, um mit antisemitischen Parolen Keile in die Partei zu treiben. Als Schlesinger während des Ersten Weltkriegs dem Verein Karl Marx, einer pazifistischen innerparteilichen Linksopposition unter Friedrich Adler, angehörte, schimpfte Pernerstorfer: ‚Dieses Häuflein besteht nicht bloß aus Akademikern, sondern auch ausschließlich aus Juden‘, sie seien allesamt ‚Internationalisten‘ und ‚kaltschnäuzig‘.“
Insgesamt gab es laut Stachowitsch und Kreisky in der Ersten Republik 14 jüdische Abgeordnete, davon zwölf Sozialdemokraten, eine Christlich-Soziale (Burjan, die zwar aus einer jüdischen Familie stammte, aber zum katholischen Glauben übertrat, wird hier mitgezählt) und einen Zionisten. „Diese Gruppe hat die Politik der Ersten Republik entscheidend mitgeprägt und im Parlament durch Gesetzesinitiativen in den Bereichen Wahlrechtserweiterung, Arbeiter- und Angestelltenschutz, Sozialversicherung, Mieterschutz, Pressefreiheit und Frauenpolitik national und regional gestaltet.“
Acht Pionierinnen mit höchst unterschiedlichem Background
1919 zogen erstmals acht Frauen in das österreichische Parlament ein. Das Gros von ihnen war sozialdemokratisch. Nur Hildegard Burjan (1883–1933) gehörte den Christlich-Sozialen an. Wie Therese Schlesinger (1863‒1940) entstammte auch sie einer liberalen jüdischen Familie – konvertierte aber 1909 zum Katholizismus. Burjan gehörte dem Hohen Haus nur kurz an und wurde vor allem durch die Gründung der religiösen Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis bekannt. 2012 wurde sie im Stephansdom selig gesprochen.
Der sozialdemokratischen Fraktion gehörten neben Schlesinger auch Anna Boschek, Emmy Freundlich, Adelheid Popp, Gabriele Proft, Amalie Seidel und Marie Tusch an. Anna Boschek (1874–1957) musste schon früh die Schule abbrechen, um zum Familieneinkommen beizutragen, und arbeitete in der Chemie- und Textilindustrie. Die spätere Pionierin der Gewerkschaftsbewegung engagierte sich vor allem in Sozial- und Arbeitsfragen. Das Gesetz zum Achtstundentag trug laut Parlamentshomepage ebenso ihre Handschrift wie Vorlagen zur Arbeitsruhe, zum Nachtarbeitsverbot für Frauen oder zum Hausgehilfinnengesetz.
Emmy Freundlich (1878–1948) kam aus einer wohlhabenden böhmischen Familie und mit Politik und sozialdemokratischen Ideen erst durch ihren Mann, Leo Freundlich, in Berührung. Von ihm ließ sie sich zwar wieder scheiden, engagierte sich aber weiter in der Arbeiterbewegung und der Genossenschaftsbewegung. Im Nationalrat meldete sie sich vor allem zu ökonomischen Fragen, aber auch zu Ernährungs- und Konsumentenangelegenheiten zu Wort. 1939 flüchtete sie mit ihren beiden Töchtern (deren Vater jüdisch war) nach England, 1947 übersiedelte sie nach New York.
Adelheid Popp (1869–1939) stammte aus einer Weberfamilie und war das jüngste von 15 Kindern. Bereits mit acht Jahren musste sie als Heimarbeiterin Geld verdienen, ab dem Alter von zehn Jahren meldeten die Eltern sie nicht mehr in der Schule an. Doch sie liebte das Lesen und bildete sich selbst fort. Sie war die erste Frau, die von einer Partei angestellt wurde, und gründete gemeinsam mit Schlesinger den Verein sozialdemokratischer Frauen und Mädchen. Zu ihren politischen Forderungen zählten eine Karenzzeit für Mütter, die Errichtung von Entbindungsanstalten und die Gleichstellung von Frauen in Ehe und Beruf.

Sozialdemokratisches Frauenkomitee (1904): Therese Schlesinger, Anna Boschek, Amalie Seidel, Adelheid Popp und Lotte Glas-Pohl (von l. nach r.)
Gabriele Proft (1879–1971) stammte aus Mähren und war Tochter eines Schusters. Mit 17 Jahren kam sie nach Wien, wo sie dem Bildungsverein Apollo beitrat und sich in der sozialdemokratischen Frauenbewegung und der Gewerkschaft engagierte. Sie gehörte zum linken Flügel der Partei und trat für eine Friedenspolitik ein. Als einzige der ersten Frauen im Parlament gehörte sie auch in der Zweiten Republik dem Nationalrat an – 1934 wurde sie bereits vom Dollfuß-Regime verhaftet und in der NS-Zeit war sie in einem Konzentrationslager interniert. Nach 1945 wurde sie Vorsitzende der SPÖ-Frauen und stellvertretende Vorsitzende der SPÖ.
Amalie Seidel (1876–1952) stammte aus einer Arbeiterfamilie. Mit 17 setzte sie den 1. Mai als arbeitsfreien Tag an ihrer Dienststelle durch – und wurde dafür am nächsten Tag entlassen. Daraufhin organisierte sie einen Frauenstreik, und so wurde Viktor Adler auf sie aufmerksam. Sie engagierte sich in der Frauenbildung und war Mitbegründerin einer Konsumgenossenschaft.
Maria Tusch (1868–1939) kam als Kind einer ledigen Magd in Klagenfurt zur Welt. Auch sie musste schon früh arbeiten – ab dem Alter von zwölf Jahren war sie in der k. u. k. Tabakfabrik in Klagenfurt als Arbeiterin tätig. Dort wurde sie Vertrauensfrau, später Betriebsrätin und schließlich Leiterin des Landesfrauenkomitees der Kärntner Sozialdemokraten. Als Abgeordnete setzte sie sich vor allem für Frauenrechte, für die Straffreiheit von Abtreibungen und für Kriegsversehrte des Ersten Weltkriegs ein. Ihre Vorträge beendete sie oft mit den Worten „Frauen, ihr müsst selbstbewusst werden!“.
Foto Alexia Weiss © Stanislav Jenis