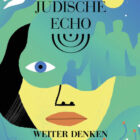Die Suffragetten von 2019

Von Tessa Szyszkowitz
Hundert Jahre nachdem die Engländerinnen das Wahlrecht erkämpft haben, steigen Frauen mit Zivilcourage in Großbritannien wieder auf die Barrikaden. Drei moderne Suffragetten im Porträt.
Alles was Recht ist – Gina Miller
Man kann sich ihre Wut vorstellen. Da träumen alte weiße Männer von einem herrlichen Brexit, und dann kommt eine junge, schöne, dunkelhäutige Frau und zwingt sie mit unbestechlicher Logik und guten Rechtsanwälten, der Realität ins Auge zu schauen. Es gibt keinen tollen EU-Austritt und vor allem keinen ungesetzlichen.
Auftritt: Gina Miller. Die Investmentbankerin war entsetzt, als Britannien 2016 für den Brexit stimmte. Erst trat Premierminister David Cameron zurück, dann kam Theresa May. Diese wollte dann Artikel 50 der EU-Verträge auslösen – die Austrittsklausel ‒, ohne vorher die Zustimmung des Unterhauses einzuholen. Gina Miller saß in ihren eleganten Büros in South Kensington und glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. Als Proeuropäerin war ihr der ganze Brexit ein Graus, aber als britische Bürgerin fand sie es fast noch schlimmer, dass die Regierungschefin vorhatte, einen Brexit-Deal ohne Parlamentsbeschluss durchzuziehen: „Wir haben nur eine ungeschriebene Verfassung“, sagte sie bei einem unserer Treffen. „Wir müssen unsere Rechte verteidigen, sonst könnten Politiker sie uns in Zukunft einfach wegnehmen.“

Abgeordnete Luciana Berger
© Wikipedia/Chris McAndrew
So wurde die 54-jährige Geschäftsfrau zur politischen Aktivistin. Miller stammt aus einer indischen Familie, ihr Vater Doodnauth Singh war Generalstaatsanwalt im südamerikanischen Britisch-Guayana. Tochter Gina hat zwar nicht Rechtswissenschaften studiert, aber den Gerechtigkeitssinn ihres Vaters geerbt. Sie initiierte den Gerichtsfall „R (Miller) gegen den Staatssekretär für den EU-Austritt“. Die britische Regierung hätte kein Recht, argumentierte sie, den Brexit am Parlament vorbei zu beschließen. „Brexit ist wie eine Religion geworden, die Vernunft ist komplett ausgeschaltet“, sagte Miller. Der Fall ging im Herbst 2016 bis zum Hohen Gericht, dann weiter zum Obersten Gerichtshof. Die Richter gaben ihr Recht. Miller hatte gewonnen.
Seitdem gründet sie immer neue Initiativen, die den Brexit stoppen oder zumindest in juristisch einwandfreie Bahnen lenken sollen. Wie viele Briten fühlt sie sich derzeit von ihrer Partei nicht mehr vertreten. Aus Protest gegen Jeremy Corbyns Brexit-Wackelkurs hat sie sich von der Labour Party abgewendet. Im Mai 2019 erregte sie mit einer Webseite Aufsehen, die den Wählerinnen bei den EU-Wahlen eine taktische Stimmabgabe empfahl. Es war praktisch ein Wahlaufruf für die Liberaldemokraten, die von Anbeginn einen eindeutigen Kurs verfolgten: „Stoppt Brexit!“ Die LibDems gewannen am Ende 16 Sitze im Europäischen Parlament.
Doch Millers erfolgreicher Aktivismus hat eine Schattenseite. Die EU-feindliche Boulevardpresse kürte sie zur „Staatsfeindin“. Eine unfassbar rassistische und sexistische Hasswelle ergießt sich permanent in den sozialen Medien über sie. Sie kann heute nicht mehr allein mit ihren Kindern auf die Straße gehen. „Die sollen sich nicht täuschen“, richtet Miller jenen aus, die ihr auf Twitter Mord und Totschlag wünschen: „Ich werde dadurch nur stärker. Wir müssen um unseren Rechtsstaat kämpfen.“
Fakten vs. Fake News – Carole Cadwalladr
Nachdem Trump im November 2016 gewählt worden war, schrieb Carole Cadwalladr für das angesehene britische Wochenblatt „Observer“ ein Feature über Fake News. „Ich fing meine Recherche ganz einfach an. Ich gab in Google Search zwei Worte ein: ,Sind Juden …?‘ Dann schlug Google als Weiterführung der Frage vor: ,… böse?‘ Ich war sprachlos“, erzählte die Reporterin in einem Talk auf dem Hay-Literaturfestival Ende Mai 2019. Schlimmer noch: „Alle Webseiten, die darunter angegeben wurden, kamen zu dem Schluss: Ja, Juden seien böse.“

Journalistin Carole Cadwalladr
© Antonio Olmos
Fakten, meint Carole Cadwalladr, werden uns im Internet nur kuratiert serviert. Damit sei noch nicht alles falsch, aber Firmen wie Google dürfe man nicht als neutrale Plattformen betrachten. Drei Jahre nach dem Beginn ihrer Nachforschungen ist Cadwalladr tief in die dunkle Welt des Cyberspace eingedrungen. Die britische Firma Cambridge Analytica hatte über eine App in Zusammenarbeit mit Facebook Daten von Millionen von Facebook-Nutzern gesammelt – ohne deren Wissen – und diese Daten dann an politisch orientierte Interessenten verkauft. Darunter waren Donald Trump und die britische Vote-Leave-Kampagne.
Cadwalladr stammt aus dem englischen Somerset, die fünfzigjährige Journalistin machte sich nach einem Studium in Oxford als Autorin einen Namen. Ihr Debütroman „The Family Tree“ wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Bekannt wurde sie in der englischsprachigen Welt aber erst in den vergangenen drei Jahren mit ihrer investigativen Arbeit. Sie hat mit einer einzigen Story den Wert von Facebook um Milliarden reduziert. Dafür bekam sie den Orwell-Preis für politischen Journalismus 2018. Cadwalladr ist der Grund, warum die romantische Liebe vieler User zu den sozialen Medien sich in eine tiefe Beziehungskrise verwandelt hat.
Auch sie hat sich dadurch viele mächtige Feinde geschaffen. Britanniens oberster Brexiteer, Nigel Farage, verweigert ihr grundsätzlich Interviews. Sie behalf sich deshalb sogar schon mit journalistischen Guerillataktiken. Um an ihn heranzukommen, ließ sie sich unter falschem Namen in seine Radiotalkshow schalten. Kaum durchgestellt, feuerte sie eine Frage an ihn ab, worauf er sie aus der Leitung werfen ließ.

Die Juristin Gina Miller versuchte, anfangs erfolgreich, den EU-Austritt mit Klagen bis zum britischen Höchstgericht zu stoppen
© Alex Schlacher
Ein Jahr lang bearbeitete sie den „Whistleblower“, der ihr als Insider Infos zur Cambridge-Analytica-Story geliefert hatte, seine Anonymität aufzugeben, um seiner – und ihrer – Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen. Christopher Wylie tat dies und Facebook-Boss Mark Zuckerberg entschuldigte sich: „Das war ein Vertrauensbruch und wir müssen uns ändern, damit wir das Vertrauen der User wieder verdienen.“ Doch Cadwalladr fordert mehr. In einem TED-Talk, also in einer Technologie-Videokonferenz, im April 2019 beschuldigte sie „die Götter des Silicon-Valleys“, wie Facebook-Gründer Zuckerberg oder Google-Gründer Larry Page, die Demokratie zu bedrohen. Manche halten sie für ihre unorthodoxen Methoden für exzentrisch, doch wer ihr zuhört, findet eine quirlige, scharfsinnige, investigative Reporterin mit einer gehörigen Portion Zivilcourage.
Wenn man heute auf Google Search geht, dann erscheint übrigens nicht mehr „Sind Juden … böse?“, sondern Antworten wie „Sind Juden … eine ethnische Gruppe?“. Und daneben steht ein Link, auf den man klicken kann: „Zeige unangebrachte Voraussagen an.“ Carole Cadwalladr – und andere, die ihren Kampf um Transparenz und Wahrheit im Internet führen – haben Spuren hinterlassen.
Courage gegen Corbyn – Luciana Berger
Wo sollte man sein, wenn man links, jüdisch und proeuropäisch ist? In England, historisch gesehen, in der Labour Party. Luciana Berger lag also nicht so falsch, als sie sich schon als Studentin dieser Partei anschloss. Unter Ed Miliband, der nach Tony Blairs zentristischer „New Labour“-Ära den Weg nach links einleitete, war Berger „Schattenministerin“ für öffentliche Gesundheit, also die im Labour-Oppositionsteam für diesen Bereich zuständige Sprecherin.
Sie saß auch noch als Ministerin für geistige Gesundheit im Jahre 2015 im ersten Schattenkabinett von Jeremy Corbyn. Nach dem EU-Referendum legte sie aus Protest über Corbyns Brexit-Haltung aber ihre Funktion zurück. „In meinem Wahlkreis haben die Leute mit großer Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt“, meinte sie bei einem Interview mit mir. „Wir sehen die Vorteile der Mitgliedschaft jeden Tag.“ Noch schwerer wog für die 38-jährige Politikerin die Haltung des siebzigjährigen Parteichefs zum Antisemitismus in der Labour Party. Obwohl er mehrfach erklärte, „den Antisemitismus in den eigenen Reihen ausrotten“ zu wollen, geschah relativ wenig. Corbyn ließ eine Untersuchung einleiten, deren Ergebnisse aber wenig daran änderten, dass sich in seinem Umfeld und in weiten Kreisen der Partei antisemitische Angriffe auf jüdische Mitglieder der Partei häuften. „Es ist völlig inakzeptabel, dass diese Attacken nicht von der Partei unterbunden werden“, sagte Luciana Berger.
Zum Bruch mit Corbyn kam es im März 2018, als sie eine öffentliche Anfrage an ihn stellte, wieso er sich im Jahr 2012 dafür starkgemacht hatte, eine offensichtlich antisemitische Wandmalerei in Ostlondon nicht zu entfernen. Sie erhielt keine Antwort. Auf einer Demonstration gegen Antisemitismus am Parlamentsplatz einige Wochen später rief sie in Richtung Jeremy Corbyn, der dem Protestmarsch ferngeblieben war: „Antisemitismus blüht und gedeiht in der Labour-Party. Es schmerzt mich, das heute sagen zu müssen.“
Im Herbst 2018 musste sie unter Polizeischutz zum Labour-Parteitag in Liverpool gebracht werden. Sechs Leute wurden wegen Todesdrohungen gegen sie verurteilt. Dass man Berger in Corbyns Umfeld zur Verräterin abstempelte, war für sie schmerzhaft. Noch schlimmer war die Tatsache, dass in ihrer lokalen Parteigruppe im Jänner 2019 zwei Misstrauensanträge gegen sie eingebracht wurden. Und zwar wegen „fortgesetzter Kritik“ am Parteichef. Der Initiator einer der Anträge hatte sie zuvor als „zerstörerische Zionistin“ bezeichnet.
Parteivize Tom Watson und Ex-Chef Tony Blair verteidigten Luciana Berger. Blair nannte ihre Behandlung in der eigenen Partei „beschämend“. Doch die damals hochschwangere Frau konnte nicht mehr bleiben. Im Februar 2019 verließ sie gemeinsam mit sechs anderen Labour-Abgeordneten die Partei: „Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass die Labour-Partei institutionell antisemitisch ist“, sagte sie in ihre Abschiedsrede.
Die Kleinpartei „Change UK“, in der sich elf Labour- und Tory-Rebellen zusammengeschlossen hatten, bröckelte bereits im Juni wieder auseinander. Luciana Berger war wegen ihrer Babypause wochenlang weniger in der Öffentlichkeit gestanden als zuvor. Vorerst blieb sie als unabhängige Abgeordnete im Parlament. Ob sie es bereut, die Labour Party verlassen zu haben? „Ich hätte so tun können, als ob nichts wäre“, meint sie in einem Videostatement, „doch dazu bin ich nicht ins Parlament gewählt worden.“
Auf dem Parlamentsplatz vor dem House of Commons wurde im Februar 2018 zum hundertsten Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts unweit vom Denkmal für Winston Churchill die erste Statue einer Frau aufgestellt. Sie stellt die Suffragette Millicent Fawcett dar, die ein Transparent in Händen hält: „Courage calls for courage everywhere.“ Ihr Aufruf zur Zivilcourage wird hundert Jahre später immer noch gehört.
Foto Tessa Szyszkowitz© Privat