„Parallele Universen“, ein Vorwort von Christian Schüller
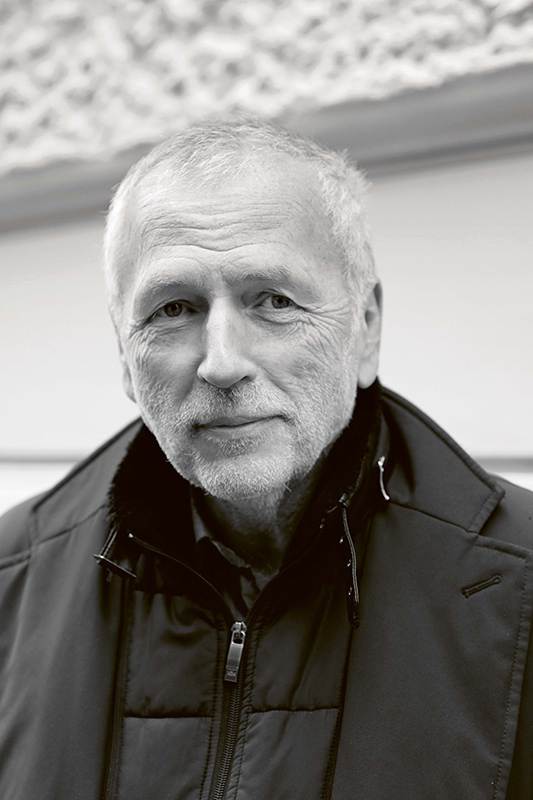
Als würde sie mit ihren Beinen auf zwei Kontinentalplatten stehen, die unter ihr auseinanderdriften, so beschreibt Julya Rabinowich das Lebensgefühl, das sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Gaza-Krieg bei ihr eingestellt hat. In kurzer Zeit seien aus Freunden Fremde geworden. Ein Medium, das vorgibt, Menschen zu verbinden und sich deshalb ‚sozial‘ nennt, ist mittlerweile zur Kampfzone mutiert, wie Celeste Ilkanaev beschreibt. Es braucht nur einen Knopfdruck, um Solidarität auszudrücken oder Hass zu verbreiten, je nachdem.
Solidarität mit dem zutiefst erschütterten Israel oder Solidarität mit wehrlosen Frauen und Kindern in Gaza? Bei dieser Aufrechnung von Gefühlen drohe die Vernunft unterzugehen, kritisiert Ben Segenreich. Nicht Solidarität brauche Israel, sondern einfach nur Fairness. Nicht weil die Shoah auf das Gewissen der Europäer:innen drückt, sollen sie zu Israel halten, sondern einfach deshalb, weil Israel im Recht sei. Für Doron Rabinovici aber ist es die rechtsgerichtete Regierungskoalition, die Israel von innen schwach und verwundbar macht. Dieser Ideologie sei das Land wichtiger als der Staat, die Erde heiliger als das Leben der Einwohner:innen.
Was Solidarität mit einem gespaltenen Israel bedeuten soll, diese Frage polarisiere zunehmend auch die jüdische Gemeinschaft in den USA, berichtet Peter Frey aus New York. Dabei sieht er auf beiden Seiten blinde Flecken. Während linken Gruppen die Empathie mit dem Existenzkampf Israels verloren gehe, würden konservative Organisationen, die bedingungslos Netanyahus Regierung unterstützen, die humanitäre Katastrophe in Gaza ignorieren.
Der welterfahrene Fernsehjournalist Friedrich Orter ordnet das aktuelle Geschehen im Nahen Osten in eine lange Geschichte von Informationskriegen ein, von Vietnam über den Kosovo bis zur Ukraine. Was gezeigt werden kann und was gezeigt werden soll, werde im Hintergrund entschieden. So würden Bilder oft die realen Schrecken eines Krieges verdecken und unser Vermögen zur Empathie zerstören.
Wenig war in letzter Zeit von jüdisch-arabischer Solidarität zu lesen, von Menschen, die sich für die Geschichte der anderen Seite interessieren. Und doch gibt es sie – mitten in Israel. Judith Stelmach erzählt von persönlichen Beziehungen zu arabischen Mitbürger:innen, die auch in den schweren Tagen seit dem 7. Oktober gehalten haben. In ihrer Arbeit am Projekt shared -society habe sie einiges über die Erfahrungen der arabischen Bevölkerung lernen müssen – Tat-sachen, die man ihr in der Schule nicht erzählt habe.
Für einen siebzigjährigen Kibbuznik sind Menschenrechte wichtiger als Territorium. Obwohl er sich als religiösen Zionisten bezeichnet, geht er regelmäßig in die Westbank, um palästinensischen Bauern und Hirten beizustehen, und legt sich dabei mit jüdischen Siedlern an. Itay Mashiach berichtet über eine Gruppe israelischer Aktivist:innen, die über Grenzen gehen.
In Frankreich gelten Stadtviertel mit einem hohen Anteil nordafrikanischer Zuwanderer:innen oft als Problemzonen. Der jüdische Bürgermeister Patrick Haddad zeigt im Pariser Vorort Sarcelles, wie ein Miteinander von jüdischen und muslimischen Französ:innen dennoch möglich ist und wo die Grenzen des Zusammenlebens liegen. Danny Leder hat den ungewöhnlichen Politiker besucht und sich im kleinen Jerusalem der Banlieue umgesehen.
Die jüngste politische Wende in Polen lässt Erinnerungen an die Zeiten der Solidarność aufleben. Damals verwendete ein Bündnis aus Arbeiter:innen und Intellektuellen die abgenutzte Propagandafloskel Solidarität, um sie gegen die Staatspartei zu wenden. Joana Radzyner schildert aus eigener Erfahrung, wie jüdische Dissident:innen in der Opposition mitmischten und später zur Zielscheibe wurden, als die erste Ernüchterung einsetzte und polnische Nationalist:innen das Ruder übernahmen.
Dass Wiener Arbeiterfamilien nicht nur anständig wohnen sollen, sondern ein Recht auf Schönheit haben, war nach dem Ersten Weltkrieg eine erstaunliche Ansage. Heute bewundern Tourist:innen aus aller Welt die Bauwerke des Roten Wien, an denen Juden und Jüdinnen maßgeblichen Anteil hatten. Wie Lilli und Werner Bauer dokumentieren, stammten einige von ihnen aus dem Bürgertum. Solidarität mit Arbeiter:innen war ihnen nicht in die Wiege gelegt worden.
Kann ein Museum heute dazu beitragen, Vorurteile -zwischen Bevölkerungsgruppen zu überwinden und Brücken zu schlagen? Barbara Staudinger hat sich mit dem Jüdischen Museum Wien genau das vorgenommen. In ihrem Beitrag erklärt sie, warum sie es für wichtig hält, mit Missverständnissen zu arbeiten, auch auf die Gefahr hin, mitunter selbst missverstanden zu werden.
Alarmiert vom Aufstieg der Rechtsradikalen in Deutschland und Österreich, fragen sich viele, warum unsere Gesellschaft dafür so anfällig ist. Sollten Toleranz, Demokratie und Solidarität nicht in der Pflichtschule vorgelebt und geübt werden? Diese Frage hat Alexia Weiss sich gestellt und nach umfangreichen Recherchen eine ernüchternde Antwort gefunden: Das österreichische Schulsystem brauche dringend einen Totalumbau, denn ohne Chancengleichheit gebe es keine Solidarität.
Emanuel Salvarani porträtiert zwei Frauen und einen Mann, die sich dazu entschieden haben, das Schicksal der nächsten Generation nicht allein dem Schulsystem zu überlassen. Sie engagieren sich im Projekt Frei.SPIEL, um jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ihre Motivation klingt einfach: Sie wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Während der Corona-Epidemie wurden Krankenpfleger:innen als Held:innen beklatscht. Alle Parteien gelobten Solidarität mit dieser schlecht bezahlten Berufsgruppe, die sich um die Schwächsten in unserer Gesellschaft kümmert. Die pensionierte Krankenpflegerin Gerlinde Kreuzeder schildert, was aus den 15 Minuten Ruhm geworden ist.
Scham und Stigmatisierung werden von Sozialwis-sen–schaftler:innen als wichtige Barrieren genannt, die Menschen mit geringem Einkommen daran hindern, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen – selbst dann, wenn sie ihnen zusteht. Mitgehn nennt sich eine Initiative, die Menschen, die es brauchen, bei Behörden und Gesundheitseinrichtungen den Rücken stärkt. Als Begleiter:innen bieten sich Menschen an, die selbst einen schwierigen Weg hinter sich haben.
Die New Yorkerin Ilse Melamid verdankt ihr Leben dem Umstand, dass sie mit einem Kindertransport den Nazis entkommen ist. Deshalb unterstützt sie heute Flüchtlinge und straffällig gewordene Jugendliche. Stella Schuhmacher hat in New York mit drei Wiener:innen zwischen 94 und 98 Jahren gesprochen, die eines gemeinsam haben: Sie wollen die Zeit, die ihnen noch bleibt, nutzen, um anderen eine Chance zu geben.
Tag für Tag die schrecklichen Nachrichten aus dem Nahen Osten anschauen und selbst nichts unternehmen, das ist für Evelyn Böhmer-Laufer und ihren Mann Ronny nicht in Frage gekommen. Achtzehn Jahre lang haben sie jüdische und arabische Jugendliche aus Israel zum Peacecamp nach Österreich eingeladen, damit sie lernen, miteinander zu reden. Jetzt setzt ihre Tochter das Peacecamp fort. Auch wenn es sich nur um eine noch so kleine Möglichkeit handle, etwas zu bewirken, so dürfe man diese nicht vorbeiziehen lassen.
Unsere Kapitel leiten wir diesmal mit Bildern der amerikanischen Künstlerin Rebecca Odes ein. Bilder von Kindern. „Letzte Woche habe ich Gesichter von Kindern gemalt, die von der Hamas als Geisel gehalten wurden. Diese Woche habe ich in die Gesichter von Kindern in Gaza geschaut, deren Leben in diesem immer tiefer werdenden Schrecken zerstört werden.“













